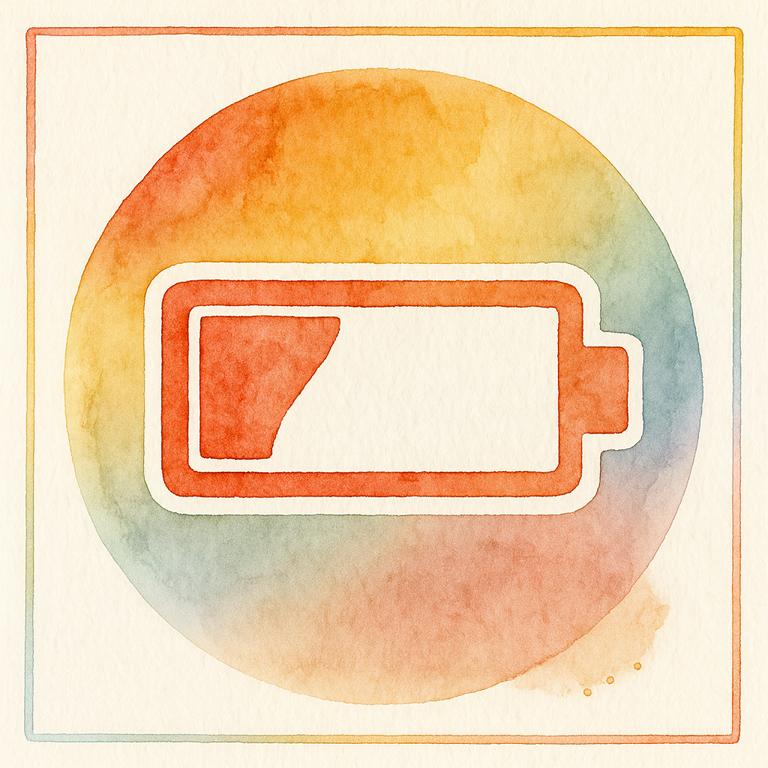Alexithymie: Wenn Gefühle schwer greifbar sind
Hast du dich auch schon mal gefragt, warum andere Menschen einen scheinbar mühelosen Überblick über ihre Emotionen haben und diese treffend beschreiben können, während dich die Frage „Wie geht es dir?“ regelmäßig völlig überfordert und vor ein großes Rätsel stellt? Bist du vielleicht ein bisschen dumm?
Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Vermutlich hast du nur Alexithymie. Was sich hinter dem sperrigen Wort verbirgt, wie die Alexithymie entsteht und wie man damit umgehen kann, erklären wir in diesem Beitrag.
1. Was ist Alexithymie?
Der Begriff Alexithymie stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich: „ohne Worte für Gefühle“ (a = nicht, lexis = Wort, thymos = Gefühl oder Seele). Gemeint ist damit die Schwierigkeit, eigene emotionale Zustände wahrzunehmen, zu benennen und einzuordnen.
Alexithymie ist kein Krankheitsbild im engeren Sinne, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das sowohl angeboren (primär) als auch erworben (sekundär, z. B. durch chronische Überforderung oder Trauma) sein kann. Etwa 10 % der Allgemeinbevölkerung sind betroffen1, bei Autist:innen liegt die Rate deutlich höher – bis zu 50 %2.

Affektive vs. kognitive Alexithymie
In der Fachliteratur wird zwischen zwei Ausprägungen unterschieden:
- Die affektive Alexithymie beschreibt eine verminderte affektive Resonanz, also eine eingeschränkte Fähigkeit, Gefühle tatsächlich wahrzunehmen oder zu erkennen. Beispiel: Ich fühle irgendwie gar nichts.
- Kognitive Alexithymie bezeichnet die Schwierigkeiten, bereits vorhandene Gefühle zu analysieren, einzuordnen und sprachlich zu vermitteln. Beispiel: Ich hab ein Gefühl, aber ich kann es nicht benennen.
Die meisten Betroffenen haben eine Mischform, wobei die kognitive Alexithymie häufiger vorkommt. Gerade im neurodivergenten Kontext zeigt sich oft: Gefühle sind durchaus vorhanden, aber sie bleiben wie ein großes, diffuses Fragezeichen unzugänglich oder sprachlich schwer greifbar.
2. Wie entsteht Alexithymie?
Neurobiologische Ursachen
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass bei alexithymen Personen bestimmte Hirnareale anders aktiviert sind, insbesondere der anteriore cinguläre Kortex (ACC), die Insula, die Amygdala und der präfrontale Kortex4. Diese Regionen sind wichtig für die interozeptive Wahrnehmung (also das Spüren körperinterner Vorgänge und Veränderungen), die Emotionsverarbeitung und die Integration körperlicher und emotionaler Signale. Es lässt sich bisher nicht ausschließen, dass neurophysiologische Besonderheiten allein (unabhängig von sozialen und umweltbedingten Faktoren) zur Entwicklung von Alexithymie beitragen können. Diese Erkenntnis ist besonders wichtig im neurodivergenten Kontext, wo oft eine Mischung aus neurologischen und sozialen Ursachen vorliegt. Menschen mit Alexithymie gehören damit zum neurodivergenten Spektrum (unabhängig davon, ob zusätzlich ein Autismus und/oder eine ADHS vorliegen).Körperliche Selbstwahrnehmung und Reizverarbeitung
Viele neurodivergente Menschen berichten, dass sie nicht nur Gefühle, sondern auch grundlegende körperliche Zustände wie Hunger, Durst, Schmerz oder Harndrang oft erst sehr spät oder gar nicht wahrnehmen. Dieses Phänomen steht in engem Zusammenhang mit einer veränderten Reizverarbeitung und eingeschränkter Interozeption, also der Fähigkeit, innere körperliche Signale wahrzunehmen und zu interpretieren.
Wenn diese körperbasierten Hinweisgeber fehlen oder nur verzögert wahrgenommen werden, erschwert das auch die emotionale Selbstwahrnehmung erheblich. Gefühle entstehen nicht im luftleeren Raum, sie sind eng mit körperlichen Empfindungen verknüpft. Wird der Körper nicht ausreichend gespürt, fehlen wichtige somatische Marker, die helfen könnten, emotionale Zustände zu erkennen und einzuordnen.
Insbesondere bei Personen mit sensorischer Über- oder Unterempfindlichkeit (häufig der Fall bei Autismus oder ADHS) kann es zu einer chronischen Verunsicherung kommen: Was ist Reiz? Was ist Gefühl? Was ist gefährlich, was nur ungewohnt? Diese dauerhafte Irritation kann dazu führen, dass das gesamte System der Selbstwahrnehmung fragil oder bruchstückhaft bleibt – ein fruchtbarer Boden für Alexithymie.
Umwelt und Beziehungserfahrungen als Auslöser
Gleichzeitig spielt die Umwelt häufig eine entscheidende Rolle: Menschen, deren emotionale Äußerungen regelmäßig ignoriert, entwertet oder bestraft werden, lernen mit der Zeit, ihre Gefühle nicht mehr wahrzunehmen oder auszudrücken. Auch in Familien mit geringer emotionaler Kommunikation sowie bei chronischer Überforderung (z. B. durch Reizüberflutung, Unsicherheit oder Trauma) kann sich Alexithymie als Schutzstrategie entwickeln: Alexithymie als Rückzug aus dem emotionalen Erleben, weil es zu verwirrend oder schmerzhaft ist.
Für viele neurodivergente Menschen ist diese Entwicklung besonders wahrscheinlich, da ihre Wahrnehmungen oft nicht verstanden oder sogar abgewertet werden („Stell dich nicht so an“, „Du übertreibst“). Solche Erfahrungen können dazu führen, dass eigene Gefühle nicht mehr als vertrauenswürdig erlebt werden.
Alexithymie kann als erlernte Schutzstrategie verstanden werden. Wenn emotionale Reaktionen regelmäßig missachtet, entwertet oder als übertrieben abgetan werden, entwickeln viele Betroffene eine Art inneren Rückzug aus dem Fühlen. Gefühle werden nicht mehr bewusst wahrgenommen, weil sie keinen sicheren Raum finden – oder zu schmerzhaft, zu verwirrend, zu ambivalent erlebt werden.
Diese Form wird auch als sekundäre Alexithymie bezeichnet. Sie entsteht nicht primär durch neurologische Faktoren, sondern als Reaktion auf anhaltende emotionale Überforderung oder wiederholte zwischenmenschliche Verletzungen. Dabei ist das Nicht-Fühlen nicht Ausdruck eines Defizits, sondern eine gelernte Form der Selbstregulation, ein Versuch, sich vor weiterer Enttäuschung, Hilflosigkeit oder Überforderung zu schützen.
Sekundäre Alexithymie ist oft reversibel, aber ihre Auflösung braucht Zeit, Sicherheit und neue Beziehungserfahrungen.
3. Wie lässt sich Alexithymie messen?
Alexithymie kann man schlecht anhand objektiver Kriterien (wie zum Beispiel einem Blutwert oder einer Verhaltensbeobachtung) messen. Grundlage für die Beurteilung, ob sie vorliegt oder nicht, ist immer die Wahrnehmung und Beschreibung der möglicherweise betroffenen Person. Obwohl die Gefühlsblindheit keine Krankheit im engeren Sinne ist, gibt es mehrere standardisierte Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung alexithymer Merkmale. Am bekanntesten ist die Toronto-Alexithymie-Skala (TAS-20). Sie ist international verbreitet, allerdings stark defizitorientiert und in der Kritik, bestimmte Aspekte (z. B. körperbasierte oder visuelle Symbolisierung) nicht ausreichend zu erfassen.
Ein alternatives, differenzierteres Verfahren ist der Perth Alexithymia Questionnaire (PAQ). Er wurde entwickelt, um zwischen der Wahrnehmung und Beschreibung positiver und negativer Emotionen zu unterscheiden und bietet eine deutlich feinere Analyse. Zudem ist er aus einer emotionspsychologischen Perspektive formuliert und lässt sich gut in psychoedukative Kontexte integrieren.
Du kannst den PAQ bei uns auf der Website als anonymen Selbsttest durchführen – inklusive Auswertung und Erläuterungen.
4. Wie fühlt sich Alexithymie an?
Gefühle sind ein innerer Kompass – sie weisen uns auf unsere Bedürfnisse, Grenzen und Wünsche hin. Wer diesen Kompass nicht spürt, merkt oft erst spät, wenn ein Job, eine Beziehung oder ein Umfeld nicht mehr gut für einen ist. Studien zeigen: Alexithymie ist eng verbunden mit psychosomatischen Beschwerden, Depressionen und Beziehungskonflikten5.
Das Fehlen emotionaler Orientierung kann auch zu Überforderung führen: Was brauche ich? Was fehlt mir? Wann ist es genug? Diese Fragen bleiben oft unbeantwortet. In Alltagssituationen bedeutet das, Entscheidungen rein analytisch-rational zu treffen oder dadurch, dass Emotionen nicht klar erkennbar sind, „alles in der Rückschau“ verstehen zu müssen. Eine Betroffene beschreibt es eindrücklich:

„Alexithymie ist so viel mehr als nur, deine eigenen Gefühle nicht zu verstehen. Es ist, nicht zu wissen, was du mit deinem Leben machen willst, oder in einem bestimmten Moment, weil du nicht spüren kannst, was sich für dich richtig anfühlt. […] Ich gehe durchs Leben und erfahre alles auf die harte Tour, weil ich keine Emotionen nutzen kann, die mich leiten.“
Diese Aussage bringt es auf den Punkt: Ohne das emotionale Navigationssystem verlässt man sich auf Trial and Error.
Ein weiterer Nutzer formuliert, was fehlt:
„Es fühlt sich an wie dieses Wort, das man vergessen hat, obwohl es auf der Zunge liegt, nur mit Gefühlen. Ich bin so nah dran, Gefühle auszudrücken oder zu empfinden, aber sie entgleiten mir doch immer wieder.“
Dieser Kommentar beschreibt eindrücklich die ständige Nähe zum Erleben und doch die unerreichbare Barriere. Das Gefühl bleibt diffus, vage, aber nicht greifbar.
Viele Betroffene nehmen Gefühle nur körperlich wahr: als Kloß im Hals, Druck im Brustkorb oder Kopfschmerz. Das kann zu Unsicherheit, sozialer Irritation und innerer Leere führen. Andere wiederum haben bereits mit dem bewussten Erkennen körperlicher Veränderungen Schwierigkeiten.
Interozeption: Der Körper als fehlender Hinweisgeber
Alexithymie tritt häufig gemeinsam mit (oder gar als Folge von?) eingeschränkter Interozeption auf – also einem verminderten Zugang zu innerkörperlichen Signalen wie Hunger, Durst oder Anspannung7. Wenn ich meinen Körper nicht spüre, kann ich die somatischen Marker von Emotionen auch nicht nutzen, um daraus Gefühle zu interpretieren.
Aphantasie: Wenn auch Bilder fehlen
Noch komplizierter wird es für Menschen mit gleichzeitiger Aphantasie (der Unfähigkeit, Bilder vor dem inneren Auge zu erzeugen). Ohne symbolische Vorstellungen fehlt oft die Brücke zwischen Empfindung und Bedeutung. Metaphern oder Imaginationsübungen, die helfen können, Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen, sind für aphantastische Menschen völlig unzugänglich.
5. Alexithymie & Autismus: Eine häufige Kombination
Bei Autist:innen ist Alexithymie deutlich häufiger vertreten (50% vs. 10% in der neurotypischen Bevölkerung). Warum? Liegt es daran, dass das Gehirn einfach auch in diesem Aspekt „anders verdrahtet“ ist?
Nicht alle Forschenden stimmen darin überein, dass Alexithymie bei Autist:innen primär neurologisch bedingt ist. Vieles spricht dafür, dass sie zu einem großen Teil durch die Reaktionen der Umwelt und die wiederholte Erfahrung emotionaler Ablehnung geprägt wird. Für eine wirklich neuroaffirmative Perspektive ist es daher zentral, Alexithymie nicht vorschnell als festes Defizit „im Gehirn“ zu begreifen – sondern als erlernte Schutzstrategie in einem nicht-validierenden Umfeld.
Invalidierung und soziale Lernerfahrungen
Viele autistische Menschen machen früh die Erfahrung, dass ihre Wahrnehmungen nicht ernst genommen oder abgewertet werden („Stell dich nicht so an“). Diese chronische Invalidierung kann zur emotionalen Selbstentfremdung führen. Gefühle werden ausgeblendet, weil sie nicht als hilfreich, relevant oder akzeptabel erlebt wurden.
Diese Dynamik wird oft nicht als Gewalt erkannt, sie ist subtil. Dennoch hat sie schwerwiegende Folgen: Wer nie gelernt hat, dass die eigenen Empfindungen richtig sind, Sinn ergeben und Beachtung finden, wird später Schwierigkeiten haben, ihnen zu vertrauen. Besonders kritisch ist dies in der Kindheit, wenn emotionale Rückmeldeschleifen fehlen (Nichtbeachtung der kindlichen Gefühle, weil diese vom Kind nicht den Erwartungen entsprechend ausgedrückt werden, z. B. Erstarren statt weinen) oder negative Reaktionen (z. B. „Jetzt sei doch nicht so empfindlich!“) dominieren. Auch gut gemeinte, aber überfordernde Anforderungen in emotional schwierigen Situationen („Sag mir ehrlich, was los ist“) können Druck erzeugen.
Masking und emotionale Erschöpfung
In Kombination mit jahrelangem Masking (also dem Versuch, sich neurotypischen Erwartungen anzupassen) entsteht oft eine Art innere Abkopplung von den eigenen Empfindungen. Ein wichtiger Aspekt des Maskierens ist es ja gerade, unangenehme Gefühle (z. B. in reizbedingt überfordernden Situationen) zu verstecken. Dazu kommt die eigene Invalidierung: Alle Leute sagen mir, dass das gar nicht so schlimm ist und scheinbar finden es die anderen auch nicht schlimm; mein Gefühl muss also falsch sein. Über Jahre hinweg kann das zu einem vollständigen Verlust der emotionalen Selbstwahrnehmung führen.
Klarheit bitte: Gefühle sind nicht eindeutig – und genau das ist das Problem
Ein weiterer, oft übersehener Aspekt: Autistische Gehirne mögen keine Unschärfen. Viele autistische Menschen bevorzugen klare, logische und eindeutige Informationen, weil sie Orientierung und Sicherheit geben. Gefühle hingegen sind selten eindeutig. Sie sind flüchtig, mehrdeutig, oft widersprüchlich. Diese Unklarheit erzeugt kognitive Dissonanz, ein Zustand, der im autistischen Erleben als besonders belastend empfunden werden kann.
Wenn ich nicht ganz eindeutig und klar sagen kann, was ich fühle, ist es manchmal einfacher, gar nichts zu fühlen.
In diesem Spannungsfeld (zwischen dem Bedürfnis nach Klarheit und der Vagheit emotionaler Prozesse) kann sich Alexithymie als pragmatische Lösung etablieren: Gefühle werden „ausgeblendet“, weil sie nicht ins System passen. So verstärken sich kognitive, soziale und emotionale Aspekte gegenseitig, bis das Fühlen selbst zum Fremdkörper wird.
6. Alexithymie als Risikofaktor
- Depression und Angst: Zahlreiche Studien belegen positive Korrelationen zwischen Alexithymie sowie depressiven und Angst-Symptomen; unabhängig von anderen Faktoren gilt sie als wesentlicher Risikomarker.6
- Essstörungen, Sucht und andere psychische Störungen: Alexithymie ist als Risikofaktor bei Essstörungen, Suchterkrankungen sowie Zwangsstörungen etabliert.
- Suizidgedanken und Selbstverletzung: Eine Meta-Analyse zeigt eine starke Beziehung zu Suizidideen (r ~ 0,54) und eine moderat positive Verbindung zu suizidalem Verhalten (r ~ 0,25)5, besonders ausgeprägt bei Schwierigkeiten, Gefühle zu benennen. Studien weisen zudem darauf hin, dass Depression als vermittelnder Faktor wirkt.
- Psychosomatische Beschwerden & chronische Schmerzen: Alexithyme Menschen finden sich in bestimmten klinischen Gruppen überdurchschnittlich wieder, z. B. bei chronischen Schmerzpatient:innen. Dahinter liegt eine verminderte Fähigkeit, innere emotionale Zustände mental zu verarbeiten. Diese drücken sich dann stattdessen in somatischen Symptomen aus.
- Lebensqualität & Stress: Alexithymie wird mit erhöhtem Stress, verminderter Lebensqualität und negativer Affektivität in Verbindung gebracht
- Körperliche Erkrankungen: Sie wird auch mit Erkrankungen wie Bluthochdruck, metabolischen Störungen, chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Migräne oder Reizdarmsyndrom assoziiert.
- Interpersonelle Schwierigkeiten: Alexithyme Menschen berichten häufig von emotionaler Distanz oder Schwierigkeiten in Bindungen, etwa durch mangelnde emotionale Differenzierung oder „extern orientiertes Denken“, das die emotionale Verbindung erschwert.
7. Kann man Alexithymie behandeln?
Therapeutische Ansätze
- Emotionsfokussierte Therapie (EFT): Ziel ist es, unterdrückte oder nicht bewusst zugängliche Emotionen in der therapeutischen Beziehung zu aktivieren, zu explorieren und zu integrieren. Besonders wirksam bei Klient:innen mit kognitiver Alexithymie.
- Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT): Fördert die Fähigkeit, mentale Zustände bei sich und anderen zu erkennen. Besonders geeignet bei Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre inneren Prozesse als „denkbar“ zu erleben.
- Kognitive Verhaltenstherapie (CBT): Hilfreich vor allem zur Erarbeitung von Emotionsvokabular, Erkennen von Auslösern und Erlernen alltagspraktischer Strategien zur Emotionsregulation.
- Körper- und achtsamkeitsbasierte Verfahren: Methoden wie Yoga, Körperpsychotherapie, Feldenkrais oder Somatic Experiencing helfen, den Zugang zu inneren Zuständen zu reaktivieren – über das Spüren, nicht über Sprache.
- Kreative Verfahren: Musik, Malen, Schreiben oder kreative Rollenspiele können emotionale Ausdrucksformen aktivieren, ohne auf ein konkretes Vokabular angewiesen zu sein.
Praktische Alltagsansätze
- Gefühlstagebücher (mit Körperbezug): Z. B. „Was habe ich in meinem Körper gespürt?“ statt „Wie habe ich mich gefühlt?“
- Emotionskarten oder -Apps zur Visualisierung und Differenzierung
- Metaphern finden: „Ich bin wie ein überfüllter Fahrstuhl.“
- Mini-Check-Ins: Drei Atemzüge, Körper scannen, einfache Frage: „Ist da was?“
- Digitale Tools: „Animi“ (englisch): Eine App zur Emotionswahrnehmung und -differenzierung für Menschen mit Alexithymie
8. Fallstricke in der Therapie
Leider haben nach wie vor nicht alle Psychotherapeut:innen das Phänomen Alexithymie „auf dem Schirm“. Und so erleben Menschen mit (unentdeckter) Alexithymie bereits den Einstieg in die Therapiestunde häufig als frustrierend oder überfordernd, weil die scheinbar einfache Befindensfrage („Wie geht es Ihnen?“) zur nicht ehrlich beantwortet werden kann. Hier entsteht schnell ein Missverständnis:
Therapeut:innen erwarten bei Intelligenz, Reflexionsvermögen und guten sprachlichen Fähigkeiten sehr oft auch eine gute emotionale Introspektionsfähigkeit. Für die meisten Menschen ist es schließlich nicht schwer, zu wissen, was sie fühlen. Wer klug ist, sollte doch auch wissen, wie es ihm oder ihr geht – oder? Und wer Schwierigkeiten hat, seine Gefühle zu benennen, wirkt auf viele Fachpersonen entweder vermeidend oder unwillig. Die eigentliche Realität (nämlich ein echtes Nichtwissen) wird dabei gar nicht erst in Erwägung gezogen.
Deshalb an dieser Stelle der wichtige Hinweise für alle therapeutisch arbeitenden Menschen: „Ich weiß es nicht“ ist kein Widerstand.
Für viele Betroffene ist es schlicht nicht möglich, inneres Erleben in Worte zu fassen, nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die Verbindung fehlt. Was innen passiert, ist diffus, körperlich, schwer greifbar. In frühen Therapiesitzungen wird dann häufig „über sich“ gesprochen, aber nicht aus sich heraus. Die Beziehung bleibt kognitiv, analytisch, korrekt – doch emotional leer. Eine häufige Rückmeldung an betroffene Patient:innen lautet dann: „Sie sind zu verkopft.“
Das erzeugt nicht selten ein Gefühl der Beschämung: Wieso gelingt mir das nicht? Warum funktioniert Therapie scheinbar bei anderen, aber nicht bei mir? Die therapeutische Situation droht, das eigene Defizit zu verdeutlichen, ohne gleichzeitig Halt zu geben oder die Hintergründe zu beleuchten. Einen Ausweg finden manche Betroffene darin, einfach „irgendwas“ zu sagen. Aber das ist natürlich keine sinnvolle Basis für die weitere Therapie.
Als Betroffener Mensch, der eine Therapie aufsucht, ist es deshalb leider manchmal nötig, die behandelnde Person explizit auf die vorliegende Alexithymie hinzuweisen und zu betonen, dass die Arbeit an und mit Gefühlen wirklich auf einem einfachen Einstiegslevel gestartet werden muss.
Und für das Fachpersonal gilt:
- Nicht konfrontieren, sondern begleiten: Der Satz „Ich glaube Ihnen“ ist hier manchmal wichtiger als jede Intervention.
- Akzeptieren von Leere: Die Lücke zwischen „Etwas ist da“ und „Ich weiß, was es ist“ aushalten.
- Indirekte Zugänge schaffen: Bilder, Körperwahrnehmung, Metaphern oder kleine Skalen („eher hell oder dunkel heute?“) können hilfreich sein.
- Keine vorschnellen Interpretationen: „Vielleicht ist da Traurigkeit?“ mag gut gemeint sein, kann aber Druck erzeugen oder fehlleiten. Besser: „Könnte auch sein, dass das Gefühl erst noch Zeit braucht.“
9. Und jetzt?
Alexithymie ist kein „Fehlen von Gefühlen“, sondern eine Schwierigkeit, diese wahrzunehmen, zu benennen und als Bedürfniskompass zu nutzen. Sie macht das Leben nicht unmöglich, aber oft ein bisschen anstrengender, verwirrender, einsamer. Und sie erklärt vieles, was für viele lange unerklärlich war: Warum bestimmte Entscheidungen sich nie gut anfühlten. Warum Beziehungen scheiterten. Warum das eigene Innenleben immer ein bisschen fremd blieb.
Die gute Nachricht: Alexithymie ist veränderbar. Nicht von heute auf morgen, nicht auf Knopfdruck, aber Stück für Stück. Was es dafür braucht, ist nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Sicherheit. Und ein Umfeld, das nicht davon ausgeht, dass man absichtlich „nicht fühlt“, sondern versteht, dass es um Zugang, Vertrauen und Zeit geht.
Für viele beginnt diese Reise mit einem Satz wie: „Ich weiß es nicht.“ Das reicht. Denn es zeigt, dass du hinschaust – und das ist vielleicht der wichtigste erste Schritt.
Quellen
- Salminen, J. K., Saarijärvi, S., Äärelä, E., Toikka, T., & Kauhanen, J. (1999). Prevalence of alexithymia and its association with sociodemographic variables in the general population. Journal of Psychosomatic Research, 46(1), 75–82. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10088984/ ↩︎
- Kinnaird, E., Stewart, C., & Tchanturia, K. (2019). Investigating alexithymia in autism: A systematic review and meta-analysis.
European Psychiatry, 55, 80–89. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6331035/ ↩︎ - (Persönlichkeitsmerkmal) – siehe auch Salminen et al. (1999): Alexithymie ist in der Bevölkerung normalverteilt.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10088984/ ↩︎ - Xu, P., et al. (2018). Structure of the alexithymic brain: A coordinate-based meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 87, 50–55. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763417305298
Shalom, D. B., et al. (2022). The amygdala–insula–mPFC network in alexithymia (Review). Frontiers. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9729692/ ↩︎
- Hemming, L., Haddock, G., Shaw, J., & Pratt, D. (2019). A systematic review and meta-analysis of the association between alexithymia and suicide ideation and behaviour. Journal of Affective Disorders, 254, 34–47. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6599888/ ↩︎
- Li, S., Zhang, B., Guo, Y., & Zhang, J. (2015). The association between alexithymia (TAS-20) and depression: A meta-analysis.
Psychiatry Research, 227(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.02.006 ↩︎ - Van Bael, K., et al. (2024). Self-reported interoception and alexithymia: Systematic review and meta-analyses.
PLOS ONE, 19(7), e0310411. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310411 ↩︎