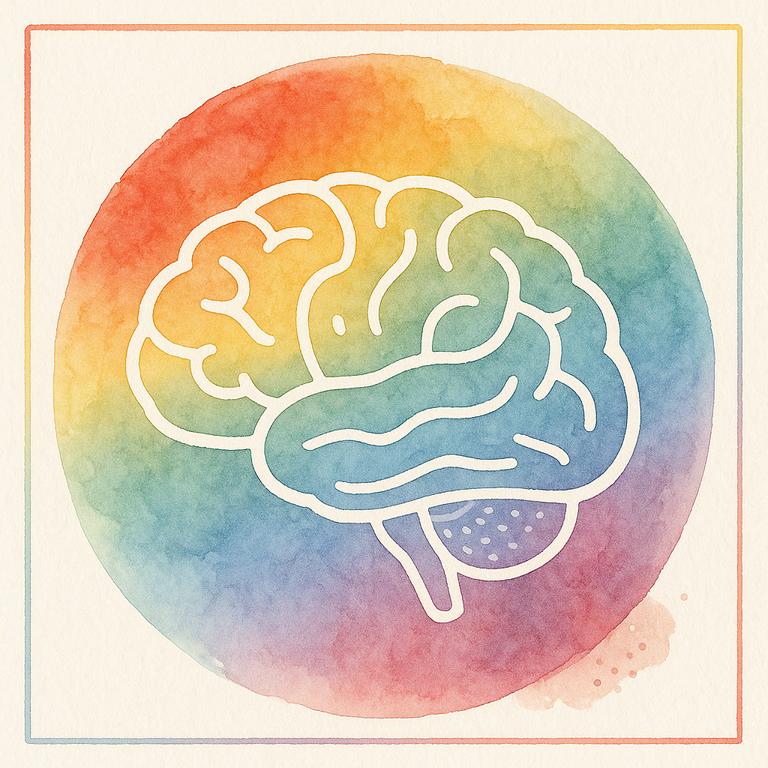Autismus bei Frauen
Autismus bei Frauen wird häufig übersehen oder erst spät erkannt. Viele Betroffene erhalten ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter, oft nach Jahren der Selbstzweifel und Fehldiagnosen. Dieser Beitrag beleuchtet die Gründe dafür und möchte betroffenen Frauen Mut machen, ihren Erfahrungen zu vertrauen.
Autismus gilt in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor als männlich. Das klassische Bild ist: der still wirkende Junge mit einem intensiven Interesse an Zügen, sozial ungeschickt, emotional distanziert, technikaffin und vielleicht sogar rechnerisch hochbegabt, also genau das Bild, das durch mediale Figuren wie Rain Man oder Sheldon Cooper ständig wiederholt wird. Dieses Stereotyp prägt nicht nur Medien und Gesellschaft, sondern auch Diagnostik, Forschung und klinische Praxis und das hat leider gravierende Folgen für Mädchen, Frauen und andere nichtmännliche Menschen, die autistisch sind.

Die Forschungslücke: zu männlich, zu schmal
Camouflaging und Masking: Anpassung um jeden Preis
Autistische Frauen und nicht-binäre Personen betreiben häufig sogenanntes Camouflaging oder Masking: Sie beobachten ihr Umfeld genau, imitieren neurotypisches Verhalten und versuchen, autistische Merkmale zu unterdrücken oder zu verstecken. Das führt dazu, dass sie im Alltag oft nicht auf- und in der Diagnostik durch das Raster fallen.
Diese Anpassungsleistung ist jedoch kein Zeichen „milderer“ Autismusformen, sondern eine enorme Belastung. Studien belegen, dass starkes Masking mit höheren Raten von Burn-out, Depressionen und Suizidalität einhergeht3.
Neurobiologische und diagnostische Mechanismen, die zur Unsichtbarkeit autistischer Mädchen beitragen
Neuere Forschung legt nahe, dass Mädchen und Frauen in gewisser Weise neurobiologisch geschützt sein könnten: Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigte, dass ein erhöhtes genetisches Risiko für Autismus bei Jungen mit auffälligen Veränderungen in bestimmten Gehirnnetzwerken verbunden war – bei Mädchen hingegen nicht4. Die Forschenden vermuten, dass es bei Mädchen Schutzmechanismen im Gehirn geben könnte, die bestimmte autistische Merkmale – wie zum Beispiel sehr auffällige, sich wiederholende Verhaltensweisen – weniger stark ausgeprägt erscheinen lassen. Das kann mit ein Grund dafür sein, warum Autismus bei Mädchen oft später erkannt wird.
Schon im Kindesalter passen sich viele autistische Mädchen unauffällig an: Sie beobachten andere genau, ahmen soziales Verhalten nach und verhalten sich so, wie es von ihnen erwartet wird – oft ohne dass Erwachsene merken, wie viel Anstrengung das kostet. Weil sie sich still anpassen und nicht mit autistischen Jungen, sondern mit neurotypischen Mädchen verglichen werden, fällt ihre Autismusdiagnose oft durch das Raster5.
Hinzu kommt: Viele autistische Mädchen zeigen keine „klassischen“ Symptome wie auffällige Sprachverzögerungen oder stereotype Bewegungen. Stattdessen wirken sie kontrolliert, angepasst oder besonders sensibel. Ihre Interessen – zum Beispiel für Tiere, Bücher oder Fantasiewelten – fallen nicht auf, weil sie gesellschaftlich als normal gelten. Auch ein hoher innerer Druck, starke Reizempfindlichkeit oder perfektionistisches Verhalten bleiben oft unbemerkt, weil sie nicht ins stereotype Bild von Autismus passen6.
Autismus bei Frauen sieht anders aus; Miss- und Fehldiagnosen
Ein weiterer zentraler Faktor ist der diagnostische Bias: Diagnostische Verfahren wie das ADOS wurden primär anhand männlicher Stichproben entwickelt und sind weniger sensitiv für feminine oder maskierte Präsentationen7. Gleichzeitig werden psychische Folgeprobleme (wie Ängste, Depressionen oder Essstörungen) häufiger als eigenständige Diagnosen gewertet, ohne den autistischen Ursprung zu erkennen6 . In der Folge erhalten viele Mädchen keine oder erst sehr spät eine Autismusdiagnose, trotz immenser innerer Belastung und einem hohen Unterstützungsbedarf.
Viele autistische Frauen erhalten über Jahre andere Diagnosen: Depression, Borderline, generalisierte Angststörung, PTBS, ADHS. Manche dieser Diagnosen sind nicht falsch, aber sie erklären nicht das ganze Bild. Der autistische Anteil bleibt oft übersehen, obwohl die autistische Wahrnehmung ganz erheblich dazu beiträgt, dass sich in einer überfordernden, für neurotypische Menschen gemachten Welt psychische Folgeprobleme einstellen.
Die Zuschreibungen entlang geschlechtlicher Stereotype beginnen früh: Wenn ein Junge nicht interagiert, wird eine Autismusdiagnose in Betracht gezogen – ein Mädchen ist dann eben schüchtern. Wenn ein Junge ein auffälliges Spezialinteresse zeigt, ist das ein Hinweis auf Autismus und die Diagnostik kommt ins Rollen – bei Mädchen wird es als „quirky“ oder Phase abgetan. Wenn es einem Jungen über längere Zeit schlecht geht, ist es womöglich Teil seines autistischen Erlebens – bei einem Mädchen wird eher an Depression oder Stimmungsschwankungen gedacht. Und wenn im jungen Erwachsenenalter erste Dekompensationen mit starken Stimmungseinbrüchen auftreten, hat der junge Mann bereits seit Jahren seine Autismusdiagnose und die Phänomene können vor dieser eingeordnet werden, während bei Frauen nun eher eine Borderline oder bipolare Störung diagnostiziert wird.
Insbesondere ADHS und Autismus werden bei Frauen oft erst im Erwachsenenalter erkannt, wenn der Leidensdruck nicht mehr kompensierbar ist. Das führt zu späten Aha-Momenten, aber auch zu Trauer darüber, nicht früher verstanden worden zu sein.
Gender Bias und stereotype Bilder
Auch stereotype Bilder von Autismus, wie sie in Medien, Schule, Familie und Therapie vermittelt werden, tragen dazu bei, dass autistische Frauen übersehen werden. In Filmen, Serien und Dokumentationen dominieren männliche Darstellungen: der technikaffine Einzelgänger, das mathematische Genie, der sozial unbeholfene Nerd. Figuren wie Sheldon Cooper in „The Big Bang Theory“ oder der junge Rain Man haben das Bild geprägt, wie Autismus vermeintlich aussieht. Dass Autismus auch anders aussehen kann (stiller, sozial integrierter, emotional feinsinnig) wird noch viel zu selten dargestellt. Medien reproduzieren so ein verzerrtes Bild, das viele reale Erfahrungen unsichtbar macht.
Eltern und Lehrkräfte erwarten oft, dass Kinder mit Autismus „auffällig“ oder „sozial distanziert“ sein müssen. In Schulen gelten Mädchen, die still, ordentlich und gewissenhaft sind, sich an alle Regeln halten und niemals negativ auffallen, als brav, dabei kann genau dieses Verhalten ein Zeichen für Masking sein.
Auch Therapeut:innen übersehen Autismus, wenn Patientinnen ihre Überforderung sozial geschickt verpacken und weil das Thema Autismus in Studium und Approbationsweiterbildung praktisch nicht vorkommt. Das führt an vielen Stellen dazu, dass neurodivergente Bedürfnisse nicht erkannt, verstanden oder ernst genommen werden.
Wie sich das Geschlechterverhältnis verändert
Früher ging man davon aus, dass Autismus etwa vier- bis fünfmal häufiger bei Jungen als bei Mädchen vorkommt. Diese Zahl wurde jahrzehntelang unkritisch übernommen und floss auch in Lehrbücher, Fortbildungen und Forschung ein. Doch neuere Studien zeigen: Dieses Verhältnis war nie ein objektives Abbild der Realität, sondern Ergebnis diagnostischer Verzerrungen8. Wenn man gezielter nach weniger offensichtlichen autistischen Merkmalen sucht und auch subtile, „gedeckte“ Präsentationen berücksichtigt, wird deutlich: Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist viel kleiner als bisher angenommen – möglicherweise liegt das tatsächliche Verhältnis näher bei 2:1 oder sogar darunter.
Auch die zunehmende Selbstaufklärung (z. B. durch Bücher, Podcasts, Social Media oder die neurodivergente Community) spielt eine wichtige Rolle: Immer mehr Frauen und nicht-binäre Personen erkennen sich in Erfahrungsberichten wieder und beginnen, ihre eigene Biografie neu zu verstehen. Für die Zukunft ist deshalb zu erwarten, dass sich das Geschlechterverhältnis weiter angleicht – je mehr stereotype Bilder von Autismus hinterfragt, überarbeitet und durch vielfältigere Darstellungen ersetzt werden.
Was sich ändern muss
Wichtig bei alldem ist: Das „Autismus-bei-Frauen“-Problem betrifft nicht nur Frauen. Die vom stereotypen Autismusbild abweichende Darstellung ist keineswegs nur bei cis weiblichen Menschen zu finden. Auch viele cis Männer zeigen eine stille, empathische, sozial orientierte Form von Autismus, die durch gängige Schemata fällt. Ebenso erleben intergeschlechtliche und trans Personen häufig eine doppelte Unsichtbarkeit, da sie weder im klinischen Blick noch in der gesellschaftlichen Vorstellung von Autismus vorkommen. Diagnostik, Forschung und Öffentlichkeit müssen also nicht nur geschlechtersensibler, sondern insgesamt vielfältiger werden.
Die Vorstellung davon, wie Autismus aussieht, muss breiter, inklusiver und geschlechtersensibler werden. Diagnostik darf sich nicht am veralteten Stereotyp orientieren, sondern muss Raum lassen für neurodivergente Vielfalt.
Das bedeutet: mehr Forschung mit diversen Stichproben. Mehr Fortbildung für Fachpersonen. Mehr Sichtbarkeit für autistische Frauen und nicht-binäre Menschen. Und vor allem: mehr Offenheit für die Tatsache, dass Autismus sich sehr unterschiedlich zeigen kann und die Diagnose trotzdem legitimiert ist.
- Bargiela, S., Steward, R., & Mandy, W. (2016). The experiences of late-diagnosed women with autism spectrum conditions: An investigation of the female autism phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(10), 3281–3294. https://doi.org/10.1007/s10803-016-2872-8 ↩︎
- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Chakrabarti, B., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: Setting the scene for future research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 11–24. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003 ↩︎
- Cage, E., & Troxell-Whitman, Z. (2019). Understanding the reasons, contexts and costs of camouflaging for autistic adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(5), 1899–1911. https://doi.org/10.1007/s10803-018-03878 ↩︎
- Lawrence, K. E., Hill, A. P., Papini, C., et al. (2022). Sex differences in functional brain connectivity associated with a polygenic risk score for autism. Molecular Psychiatry, 27, 3027–3035. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01324-4 ↩︎
- Hull, L., Mandy, W., & Petrides, K. V. (2017). Behavioural and cognitive sex/gender differences in autism spectrum condition and typically developing males and females. Autism, 21(6), 706–727. https://doi.org/10.1177/1362361316669087 ↩︎
- Gould, J., & Ashton-Smith, J. (2011). Missed diagnosis or misdiagnosis? Girls and women on the autism spectrum. Good Autism Practice (GAP), 12(1), 34–41.
- Gabrielsen, T. P., Farley, M., Speer, L., et al. (2019). Identifying autism in females: A clinical challenge. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 24(2), 237–248. https://doi.org/10.1177/1359104518809271 ↩︎
- Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(6), 466–474. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.03.013 ↩︎