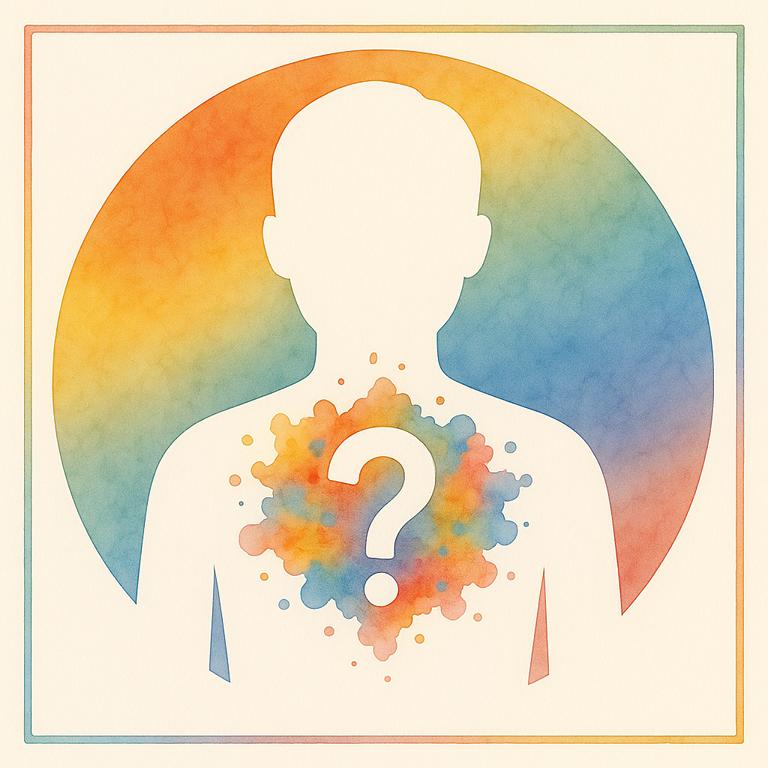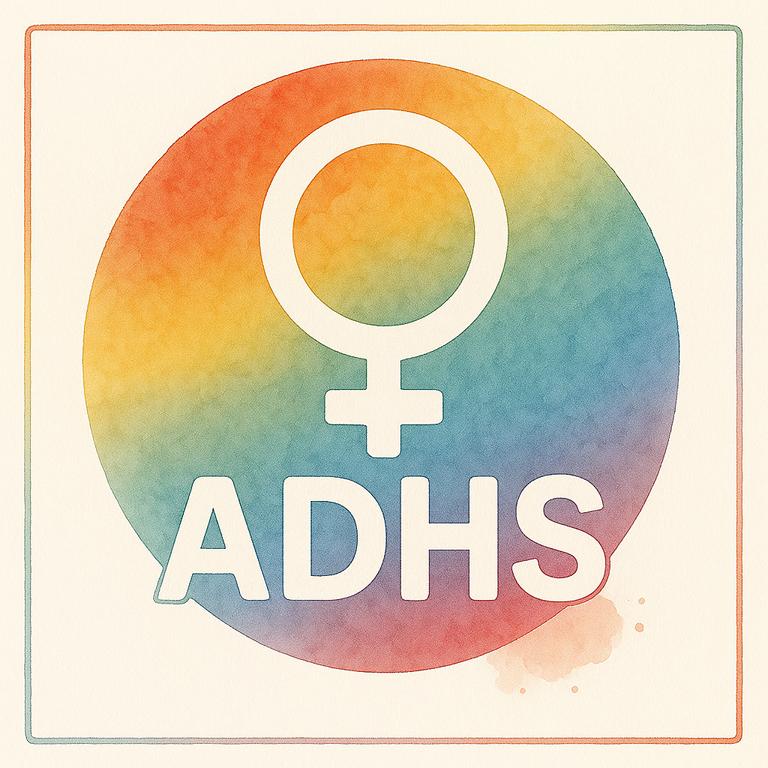Autismus-Diagnose: Kriterien, Hürden und Selbstidentifikation
Wenn du diesen Beitrag liest, dann vermutlich deshalb, weil du bei dir selbst oder einer nahestehenden Person das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung vermutest. Vielleicht beginnst du gerade erst damit, dich zum Thema zu informieren und jede Menge über Neurodivergenz zu lernen. Vielleicht trägst du den Gedanken aber auch schon eine Weile mit dir rum, verwirfst ihn, greifst ihn wieder auf, verwirfst ihn wieder…
Autismus. Könnte sein.
Du erkennst dich vielleicht in Beschreibungen wieder, die du online gelesen oder in einer Fernsehsendung gesehen hast. Nicht in allen, aber in genug. Manche Phänomene deines Lebens ergeben vor dem Hintergrund einer Autismus-Diagnose plötzlich Sinn. Verhaltensweisen, Reaktionen, Reizempfindlichkeiten. Dinge, die du bisher als „komisch“, „übertrieben“ oder „seltsam“ eingeordnet hast, lassen sich rückblickend einordnen. Und jetzt überlegst du, ob du dich diagnostizieren lassen solltest.

Vielleicht hast du schon recherchiert. Vielleicht warst du schon bei einer Fachperson. Vielleicht hat dir auch jemand anderes dazu geraten, „das mal abklären zu lassen“. Vielleicht überlegst du noch, ob sich das alles überhaupt lohnt. Ob du das brauchst. Ob du dir das eventuell doch nur einbildest. Und ob du überhaupt ernst genommen wirst.
Dieser Beitrag erklärt, wie eine Autismus-Diagnose zustande kommt. Welche Kriterien gelten. Was eine gute Diagnostik leisten kann. Und warum viele Menschen keine Diagnose bekommen, obwohl sie auf dem Spektrum. Wir stellen Anlaufstellen, Methoden und Hürden und vor, damit du die Entscheidung, ob du dich diagnostizieren lassen sollst, gut informiert treffen kannst.
Was bedeutet eine Autismus-Diagnose eigentlich?
Eine Autismus-Diagnose ist eine medizinisch definierte Beschreibung von bestimmten Unterschieden in Wahrnehmung, Reizverarbeitung, Kommunikation, sozialen Fähigkeiten und Interessen.
In Deutschland wird dabei aktuell immer noch nach den Kriterien des ICD-10 diagnostiziert. Dort gibt es noch keine Kategorie für die „Autismus-Spektrum-Störung“ (die taucht erst im ICD-11 auf, welche bereits seit 2022 in Kraft ist, aus bürokratischen Gründen aber noch nicht abgerechnet werden kann), sondern getrennte Diagnosen wie „Frühkindlicher Autismus“, „Atypischer Autismus“ und „Asperger-Syndrom“.

Gerade bei Erwachsenen wird, wenn die Diagnosekriterien zutreffen, in aller Regel hilfsweise die Diagnose „Asperger-Syndrom“ vergeben, auch wenn der Begriff fachlich längst überholt ist. Der moderne Begriff wäre: Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Offiziell wird Deutschland in den nächsten Jahren auf den ICD-11 umstellen. Dort ist das Spektrum zusammengefasst, geschlechtsneutraler formuliert und näher an aktuellen Forschungsergebnissen orientiert. Aber bis dahin gilt: Wer heute eine Diagnose sucht, bekommt sie meist noch nach den alten Kriterien.
Damit eine Autismus-Diagnose gestellt werden kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Es braucht Auffälligkeiten in zwei groben Bereichen:
Schwierigkeiten in der wechselseitigen sozialen Interaktion und Kommunikation, sowie eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten.
Die Beschreibungen sind Originalzitate aus dem ICD. Neuroaffirmativ würde man unter Punkt 1 hinzufügen, dass die Schwierigkeiten im Kontakt mit allistischen (also nicht autistischen) Personen auftauchen, jedoch nicht oder deutlich reduziert mit anderen autistischen Menschen. Punkt 2 würde man neuroaffirmativ besser als „Vorliebe für Routinen, Wiederholungen, Planbarkeit, Bekanntes und Vorhersehbarkeit und möglicherweise intensiven Interessensgebieten“ beschreiben.
Neben diesen beiden Kernkriterien muss ein durch eben diese ausgelöster Leidensdruck vorhanden sein. Ebenso müssen Funktionseinschränkungen in ein oder mehreren Lebensbereichen vorliegen (z. B. unzureichende Sozialkontakte wegen interaktionellen Problemen, Probleme in Schule, Ausbildung oder Beruf wegen starrer, unflexibler Routinen oder Schwierigkeiten mit Vorgesetzten und Hierarchien).
Eine Autismus-Diagnose ist somit ist eine fachliche Einschätzung anhand von klar definierten Kriterien, die einen Zugang zu Therapien, Leistungen, Schutzrechten, Nachteilsausgleichen eröffnen kann. Und manchmal auch einfach zu dem Gefühl, endlich ernst genommen und verstanden zu werden.
Die Autismus Diagnostik - in der Theorie
Wer darf eine Autismus-Diagnose stellen?
In Deutschland orientiert sich die Diagnostik bei Autismus formal an der S3-Leitlinie „Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“. Diese wurde zuletzt im April 2015 überarbeitet und gilt seit 2020 als abgelaufen. Eine inhaltliche Aktualisierung ist längst überfällig, denn die Forschung hat sich seither deutlich weiterentwickelt. Bis auf Weiteres arbeiten Fachpersonen jedoch mit diesem Stand.
In der Leitlinie steht, dass die Diagnose durch Fachärzt:innen gestellt werden muss – typischerweise aus den Bereichen Psychiatrie, Neurologie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie. Psychologische Psychotherapeut:innen werden nicht ausdrücklich erwähnt. Aus diesem Grund gibt es leider immer noch (wenige) Stellen, die eine durch eine:n Psychotherapeuten:in gestellte Autismus-Diagnose nicht anerkennt und behauptet, diese dürfe nur von ärztlichen Kolleg:innen gestellt werden.

Das ist falsch! Bereits seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes im Jahr 1999 sind approbierte Psychotherapeut:innen dazu befugt, Diagnosen aus dem Kapitel F (in dem auch die Autismus-Störungen zu finden sind) zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Approbationsreform von 2020 hat die Gleichstellung psychologischer und ärztlicher Kolleg:innen weiter rechtlich untermauert. Das bedeutet: Fachärzt:innen, psychologische Psychotherapeut:innen und Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen dürfen in Deutschland eine Autismus-Diagnose stellen.
Wie wird eine Autismus-Diagnose gestellt?
Dass Psychologische Psychotherapeut:innen genauso befähigt sind, Autismus zu diagnostizieren, macht vor dem Hintergrund Sinn, dass eine Autismus-Diagnose nicht zum Beispiel durch einen Blutwert oder ein Hirn-MRT oder andere körperliche Marker gestellt werden kann. Wir kennen bisher keine spezifischen körperlichen Marker, anhand deren man sicher eine Diagnose stellen könnte.
Deshalb sieht die auch schon die veraltete S3-Leitlinie eine sogenannte „klinische Gesamteinschätzung“ vor. Diese setzt sich aus mehreren Elementen zusammen:
- strukturierte, autismusspezifische Anamnese
- standardisierte Fragebögen und klinische Interviews
- Verhaltensbeobachtung
- Einbezug von Selbst- und Fremdberichten
Die Diagnostik ist theoretisch geregelt, wird praktisch aber leider stellenweise inkonsistent durchgeführt. Das Ergebnis hängt zu einem großen Teil davon ab, an wen man gerät. Und ob die Person bereit ist, mehr zu sehen als das, was unmittelbar auffällig wirkt.
Warum du vielleicht keine Diagnose bekommst, obwohl du autistisch bist
Erste Hürde: überhaupt einen Diagnostikplatz finden
Leider ist das diagnostische und behandlerische Angebot für autistische Menschen völlig unzureichend. Das liegt einerseits daran, dass ärztliche und psychologische Therapeut:innen in der Ausbildung wenig bis nichts über Autismus lernen und sich in dem Thema nicht kompetent fühlen, andererseits daran, dass die Diagnostik im GKV-System im Vergleich zu anderen Tätigkeiten weniger lukrativ ist.
Bevor überhaupt an Diagnostik zu denken ist, scheitert es also oft schon an der Terminvergabe. Die Wartezeiten betragen regeläßig 1,5-2 Jahre und wenn du Pech hast, sind die Wartelisten in deiner Region komplett geschlossen. Viele spezialisierte Autismuszentren in Deutschland nehmen aktuell keine neuen Patient:innen mehr auf.

Besonders schwer haben es gesetzlich Versicherte und Erwachsene. Fachzentren sind häufig auf Kinder und Jugendliche spezialisiert, Diagnostikangebote für Erwachsene bleiben dünn gesät. Ein Diagnostikplatz muss aktiv erkämpft, im Notfall selbst gezahlt und mit viel Geduld abgewartet werden. Das ist natürlich überhaupt nicht okay, eine strukturelle Unterversorgung und Benachteiligung autistischer Menschen, aber es ist für den Moment leider einfach so.
Zweite Hürde: Veraltete und ungeeignete Diagnostikverfahren
Wer schließlich doch einen Diagnostiktermin bekommt, sieht sich leider häufig einem Verfahren gegenüber, das stark auf das von außen beobachtbare Verhalten gewichtet. Besonders das ADOS-2 gilt immer noch als Goldstandard. Es wurde ursprünglich für Kinder entwickelt und besteht aus einer Reihe von „Spielszenarien“. Ziel ist es, durch den Testleiter oder die Testleiterin, „autistisches Verhalten“ zu beobachten – in einer künstlichen Testsituation, innerhalb kurzer Zeit, unter Fremdbeobachtung. Was für Kinder, die (noch) nicht in der Lage sind, reflektiert über ihr Erleben zu berichten, ein wertvolles und legitimes Diagnostik-Tool ist, weist für kognitiv fitte Erwachsene eine eingeschränkte diagnostische Qualitäten auf.1
Das Problem: Viele erwachsene Autist:innen haben gelernt, sich anzupassen. Sie funktionieren sozial, sie imitieren Blickkontakt, sie beantworten Fragen höflich und kontrolliert. Innen kann gleichzeitig alles brennen. Aber das sieht niemand, weil die Betroffenen geübt haben, es zu verstecken.
In der Diagnostik anderer psychischer Erkrankungen reicht oft der Bericht der betroffenen Person. Niemand muss eine Panikattacke vorführen, um eine Angststörung diagnostiziert zu bekommen. Auch berichtete Schmerzen werden ernst genommen, ohne dass jemand sich stöhnend auf dem Boden krümmen muss. Bei Autismus dagegen gilt: Nur wer „komisch genug“ wirkt und seine sozial-interaktionellen Schwierigkeiten in einer kurzen, künstlichen Situation zur Schau stellt, bekommt die diagnostische Anerkennung. Genau das machen aber gerade stark maskierende autistische Menschen nicht.
Das ist nicht nur fachlich fragwürdig. Es ist entmündigend. Und es führt dazu, dass viele leer ausgehen – obwohl sie sich und ihre Wahrnehmung sehr präzise beschreiben könnten
Dritte Hürde: Strukturelle Ausschlüsse und veraltete stereotype Filter
Hinzu kommt: In einigen Fachzentren gibt es interne Quoten. Zum Beispiel die Vorgabe, höchstens 30 oder 40 Prozent der untersuchten Personen als Autist:innen zu diagnostizieren. In einem dokumentierten Fall sogar nur 20 Prozent. Das führt dazu, dass Diagnosen nicht primär auf individueller Einschätzung beruhen, sondern auf einer statistischen Vorgabe. Manchmal wird das sogar als Qualitätsmerkmal dargestellt: „Wir sind besonders sorgfältig, weil wir so wenige Diagnosen vergeben.“ In Wahrheit bedeutet es: Nur wer extrem auffällig ist, wird berücksichtigt. Der Rest fällt durch.
Beispiele aus der Praxis:
Ein 14-Jähriger äußert selbst einen Verdacht auf Autismus. Die ADOS-Werte sind auffällig, aber knapp unter dem Schwellenwert. Keine Diagnose. Begründung im Gutachten unter anderem: „Er zeigt soziales Lächeln.“ Rückmeldung im Elterngespräch: „Er wurde zu gut gefördert. Vor zwei Jahren hätte er die Diagnose noch bekommen.“
Nein, man kann Autismus nicht „wegfördern“. Die Person hat einfach nur gelernt, zu maskieren und ihr autistisches Erleben und Verhalten besser zu verstecken.
Erwachsener Mann mit hohem AQ-Wert, umfassendem schriftlichen Bericht, klaren Beschreibungen von Überforderung, Reizempfindlichkeit, Routinen, sozialen Schwierigkeiten. Keine Diagnose. Begründung: „Zu empathisch.“ Und: „Kein Spezialinteresse seit der Kindheit.“
Das ist keine hinreichende Begründung für den Ausschluss einer Autismusdiagnose! Nirgendwo steht, dass die besonders intensiven Interessen gleichbleibend seit Kindheit bestehen müssen. In der Praxis ändern die sich bei einigen autistischen Personen häufig, gerade wenn zusätzlich ADHS vorliegt. Und natürlich können autistische Personen empathisch sein, manche sogar hyperempathisch.2
Im schlimmsten Fall bekommen Betroffene von Fachpersonen noch vor der Diagnostik zu hören: „Sie sehen nicht autistisch aus.“ Oder: „Sie sind doch verheiratet. Autisten führen keine Beziehungen.“ Oder: „Sie haben studiert.“ All das sind absolut keine Ausschlusskriterien für Autismus, auch wenn diese veraltete Ansicht noch in einigen Köpfen steckt. Aber solche Aussagen sind zutiefst verunsichernd und führen häufig dazu, dass Menschen ihren Versuch, eine Diagnose zu erhalten, entmutigt abbrechen.
4. Hürde Ausweichdiagnosen statt Autismus-Diagnose
Wenn eine Autismusdiagnose nicht gestellt wird (z. B. weil sich die Person im diagnostischen Gespräch relativ neurotypisch präsentiert hat), kommen oft andere zur Anwendung: Generalisierte Angststörung, rezidivierende Depression (immer verbunden mit Überforderung/Überlastung), Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörungen (schizoid, zwanghaft, dependent, histrionisch, gerne auch Borderline…).
Diese Diagnosen sind nicht zwingend falsch. Sie beschreiben reale Symptome, sie benennen Leidensdruck. Aber sie bleiben beschreibend. Ein Etikett nach dem anderen – ohne verbindende Idee. Was fehlt, ist ein Erklärungsmodell. Autismus könnte genau das leisten: Das als autistisch identifizierte Neuroprofil würde viele dieser Symptome integrieren und in Zusammenhang setzen.

Es könnte erklären, warum der Zwang nicht besser wird, obwohl die Therapie nach Lehrbuch läuft. Warum die Depression immer wiederkommt. Warum Verhaltensaktivierung als anstrengend und nicht depressionsmindernd erlebt wird. Warum die „soziale Phobie“ nicht durch mehr Übung verschwindet. Weil es sich nicht um isolierte Störungen handelt, sondern um Ausdrucksformen eines autistischen Nervensystems, das andere Bedürfnisse hat.
In einigen Fällen wirken diese Nebendiagnosen wie Ersatzlösungen. Wenn keine Autismusdiagnose „mehr frei“ ist (z. B. weil das Zentrum seine Quote erreicht hat) bekommt man eben das, was noch verfügbar ist. So entsteht eine Sammlung von Symptomkomplexen, ein diagnostischer Flickenteppich. Und die Frage, warum trotz aller Diagnosen keine echte Entlastung eintritt. Dabei ist die Autismus-Spektrum-Störung das beste Erklärungsmodell für all die verschiedenen Symptome, was unsere diagnostischen Kataloge im Angebot haben.
Die Balance zwischen Sorgfalt und Willkür
Diagnosen sind keine Meinungen. Sie sind auch keine Belohnung für besonders „auffälliges“ Verhalten. Sie sind eine fachliche Einschätzung auf Basis definierter Kriterien – mit dem Ziel, Menschen zu helfen, nicht sie zu kategorisieren.
Natürlich darf eine Autismus-Diagnose nicht leichtfertig gestellt werden. Sie basiert auf definierten Kriterien, setzt eine gründliche klinische Einschätzung voraus – und sie hat Konsequenzen. Eine Diagnose eröffnet nicht nur potenziell den Zugang zu Hilfen, Therapien und Nachteilsausgleichen, sie wirkt auch identitätsprägend. Gerade deshalb ist eine gewissenhafte, fundierte Diagnostik unabdingbar.
Aber: Eine sorgfältige Einschätzung ist etwas anderes als das mechanische Abhaken von Symptomen. Wenn klar beschriebene Muster vorliegen – konsistent, überdauernd, funktional beeinträchtigend – dann darf eine Diagnose nicht an einem einzelnen, knapp verfehlten Cut-off-Wert scheitern. Auch nicht an einer vermeintlich „zu guten“ sozialen Anpassungsleistung.
Es geht nicht darum, Diagnosen leichtfertig zu vergeben. Aber es geht darum, sie dort nicht zu verweigern, wo sie klinisch gerechtfertigt wäre, nur weil eine Person gelernt hat, ihre Schwierigkeiten zu kompensieren. Eine professionelle Diagnostik erkennt Muster, nicht nur Messwerte.
Für Fachpersonen, die erwachsene Patient:innen differenziert und auf Augenhöhe einschätzen möchten, lohnt sich ein Blick auf das strukturierte Interview ACIA („Autism Clinical Interview for Adults“) – ein relativ neues, forschungsbasiertes Instrument, das speziell für die klinische Einschätzung von Autismus im Erwachsenenalter konzipiert wurde und eine hervorragende Alternative zum ADOS-2 darstellt.
Zwischen Frustration und Fortschritt: Ein Ausblick
Die Autismusdiagnostik im Erwachsenenalter ist in Deutschland kein durchgängig verlässliches System und gefühlt hinken wir da im internationalen Vergleich hinterher. Es gibt strukturelle Lücken, veraltete Methoden, stereotype Ausschlusskriterien – und viele Menschen, die durch all das keine Diagnose bekommen, obwohl sie sie bräuchten.
Aber: Es bewegt sich etwas. Es gibt inzwischen auch viele Kliniker:innen, die nach aktuellem wissenschaftlichem Stand arbeiten. Die wissen, dass Masking kein Ausschlusskriterium ist. Die neuere Testmethoden und Verfahren nutzen, z. B. das ACIA (ein klinisches Interview, das speziell für die Diagnostik Erwachsener entwickelt wurde). Die Is this Autism von Donna Henderson gelesen haben (übrigens nicht nur für Kliniker:innen eine absolute Leseempfehlung!). Die neurodivergente Lebensrealitäten ernst nehmen und nicht mit Checklisten abgleichen.
Es gibt bessere Fragebögen, mehr Aufklärung, wachsendes Fachwissen. Was noch fehlt, ist die breite Umsetzung. Es wird dauern, bis sich dieses Verständnis überall durchgesetzt hat. Aber es kommt.
Selbstidentifikation statt offizieller Autismus-Diagnose
Und bis dahin gilt: Deine Wahrnehmung zählt. Auch dann, wenn du (noch) keine Diagnose hast. Auch dann, wenn dir jemand gesagt hat, du seist „zu sozial“, „zu empathisch“, „zu funktional“. Du darfst deine Erfahrung ernst nehmen und du darfst eine Sprache dafür finden. Du darfst sagen: Ich bin autistisch, wenn du denkst, dass deine Erfahrungen, dein Verhalten und deine Wahrnehmung gut zu dem passen, was du über Autismus gelernt hast.
Möglicherweise entspricht das nicht deinem (typisch autistischen) Bedürfnis nach Klarheit, nach 100% Sicherheit, aber: Die Selbstidentifikation als autistische Person ist völlig legitim. Als selbstidentifizierte:r Autist:in bekommst du leider keinen Nachteilsausgleich und auch sonst keine Hilfen, möglicherweise auch keinen Zugang zu Selbsthilfegruppen. Aber vielleicht erlangst du mehr Verständnis für dich selbst, für deine Bedürfnisse und Grenzen. Es ist ganz egal, ob dir jemand eine offizielle Autismusdiagnose ausstellt, oder nicht: Am Ende sollte es dir darum gehen, dich und deine Bedürfnisse ernstzunehmen und die Welt um dich herum so einzurichten, dass es dir gut geht.
Hier bei Neurodinge möchten wir eine Anlaufstelle für alle Menschen sein, die ein autistisches Neuroprofil haben – unabhängig davon, ob sie offiziell diagnostiziert sind oder sich selbst identifizieren. Weil Autismus nicht an der Unterschrift einer Fachperson beginnt. Sondern bei dir.
- Maddox, B. B., Brodkin, E. S., Calkins, M. E., Shea, K., Mullan, K., Hostager, J., Mandell, D. S., & Miller, J. S. (2017). The Accuracy of the ADOS-2 in Identifying Autism among Adults with Complex Psychiatric Conditions. Journal of autism and developmental disorders, 47(9), 2703–2709. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3188-z. ↩︎
- Shalev, I., Warrier, V., Greenberg, D. M., Smith, P., Allison, C., Baron-Cohen, S., Eran, A., & Uzefovsky, F. (2022). Reexamining empathy in autism: Empathic disequilibrium as a novel predictor of autism diagnosis and autistic traits. Autism research : official journal of the International Society for Autism Research, 15(10), 1917–1928. https://doi.org/10.1002/aur.2794 ↩︎