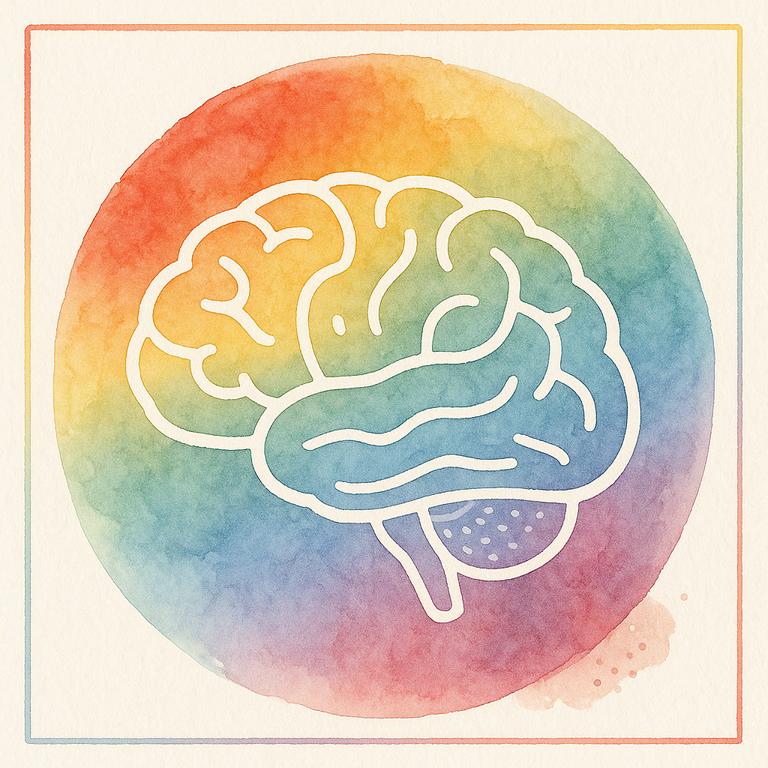Autistischer Burnout
Was ist los mit mir?
Viele autistische Erwachsene (besonders Frauen, die erst spät im Leben eine Diagnose erhalten) erleben Phasen schwerster Erschöpfung in Ihrem Leben, in denen scheinbar nichts mehr geht: Arbeit, soziale Kontakte, selbst einfache Alltagsaufgaben werden überwältigend. Oft kommt diese Erfahrung nicht aus dem Nichts, sondern nach Jahren oder Jahrzehnten des Sich-Anpassens, Maskierens und Funktionierens.
Dieses Phänomen trägt in der internationalen Forschung den Namen autistic burnout. Auf Deutsch: autistischer Burnout. Anders als das arbeitsbezogene Burnout-Konzept der WHO umfasst der autistische Burnout nicht nur berufliche Belastungen, sondern das gesamte Leben: soziale, sensorische, organisatorische und emotionale Anforderungen. Die Forschung zu diesem Phänomen steckt noch in den Kinderschuhen, aber Betroffene und die Fachwelt beschreiben ein ähnliches Bild: langfristige Erschöpfung, reduzierter Zugang zu oder Verlust von Fähigkeiten, und eine deutlich geringere Toleranz gegenüber Reizen1.

Unser Ziel mit diesem Beitrag ist es, das Konzept verständlich zu machen, die Unterschiede zu ähnlichen Zuständen wie Depression oder klassischem Burnout zu verdeutlichen, und evidenzbasierte Wege aufzuzeigen, wie man damit umgehen kann. Wir verwenden in diesem Artikel den englischen, etablierten Begriff gleichwertig mit der deutschen Übersetzung, gemeint ist jeweils dasselbe Konzept.
Definition des 'autistic burnout' & Abgrenzung
Arbeitsdefinition
Laut einer Konsensdefinition von Betroffenen, Forscher:innen und Fachpersonen beschreibt autistic burnout einen Zustand von:
- Langanhaltender Erschöpfung (meist mehrere Monate oder länger),
- Verlust von Fähigkeiten – besonders in Bereichen wie Kommunikation, Alltagsorganisation und Reizverarbeitung, sowie
- geringerer Toleranz gegenüber Reizen – Geräusche, Licht, soziale Interaktionen, Anforderungen.
Diese Merkmale treten typischerweise nach anhaltender Überlastung auf, oft in Verbindung mit unzureichender Unterstützung und hohen Anpassungsleistungen (Masking)2.
Abgrenzung zur Depression
Abgrenzung zum arbeitsbezogenen Burnout
Warum diese Abgrenzung wichtig ist
Ohne klare Differenzierung droht sogenanntes diagnostic overshadowing: Symptome werden fälschlich auf eine Depression oder „normales“ Burnout zurückgeführt, während die autismus-spezifischen Ursachen und passende Unterstützungsmaßnahmen übersehen werden. Das kann zu Behandlungen führen, die den Zustand sogar verschlechtern – etwa wenn zusätzliche Anforderungen auferlegt werden, ohne die Belastungsursachen zu reduzieren5. Häufig fragen sich (möglicherweise noch nicht korrekt identifizierte) autistische Patient:innen, warum ihre Depression denn trotz all ihrer Bemühungen, ihrer Therapiemotivation dem Erledigen von Selbstfürsorgehausaufgaben nicht besser wird und erleben hierin ein (erneutes) Scheitern. „Nicht mal Therapie kann ich, sogar dafür bin ich zu komisch.“
Wie fühlt sich autistischer Burnout an?
Symptome & Frühwarnzeichen
Viele Betroffene beschreiben autistic burnout als einen Zustand, in dem „nichts mehr geht“, nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv und emotional. Es ist mehr als Müdigkeit: Es fühlt sich an, als wären die inneren Ressourcen erschöpft, selbst für Aufgaben, die sonst mühelos gelingen. Irgendwie ist die Batterie komplett leer oder lädt nur noch auf 20% auf.
Typische Merkmale
Obwohl das Empfinden natürlich immer individuell ist, können in der Regel diese Hauptsymptome bei einem autistischen Burnout identifiziert werden:
- Schwerwiegende Erschöpfung: Auch nach ausreichend Schlaf bleibt das Gefühl, „leer“ zu sein. Schon kleine Aufgaben können unverhältnismäßig viel Energie kosten.
- Funktionsverluste: Fähigkeiten wie Reizfilterung, Planung, Kommunikation oder Selbstorganisation funktionieren spürbar schlechter als sonst. Manche erleben Wortfindungsstörungen oder verlieren vorübergehend die Fähigkeit, in ganzen Sätzen zu sprechen.
- Sensorische Überempfindlichkeit: Geräusche, Licht, Gerüche oder Berührungen, die vorher tolerierbar waren, werden plötzlich überwältigend.
- Emotionale Dünnhäutigkeit: Geringere Stresstoleranz, Reizbarkeit oder das Gefühl, ständig „am Limit“ zu sein.
Frühwarnzeichen
Typische Frühwarnzeichen eines autistischen Burnouts können sein:
- Häufige Meltdowns oder Shutdowns, auch bei scheinbar kleinen Auslösern.
- Rückzug/Vermeidung von sozialen Kontakten (nicht aus Desinteresse, sondern weil selbst kurze Interaktionen überfordernd sind).
- Zunehmende Vergesslichkeit oder Schwierigkeiten, Routinen einzuhalten.
- Häufung von kleinen Fehlern im Alltag (z. B. Termine verwechseln, Aufgaben vergessen).
- Deutlich längere Erholungszeiten nach sozialen oder sensorischen Belastungen.
- Reduziertes oder gesteigertes Engagement in den eigenen intensiven Interessen.
- Veränderung der Routinen, Reduktion selbstfürsorglicher oder selbstpflegender Tätigkeiten.
Viele berichten, dass diese Veränderungen schleichend einsetzen. Oft wird der Zustand erst dann als Burnout erkannt, wenn er bereits mehrere Wochen oder Monate anhält6.
Wie entsteht der autistische Burnout?
Belastungsmodell & Ursachen
Individuelle Faktoren
- Masking/Camouflaging: Viele autistische Menschen verbringen enorme Energie darauf, ihre Autismus-Merkmale zu verbergen oder neurotypische Verhaltensweisen nachzuahmen. Studien zeigen, dass dies direkt mit Erschöpfung, Angst, Depression und erhöhter Suizidalität verbunden ist7.
- Sensorische Sensitivität: Dauerhafte Reizüberflutung (Licht, Geräusche, Gerüche, Berührungen) erhöht die Grundbelastung.
- Exekutive Funktionen: Schwierigkeiten bei Planung, Priorisierung oder Aufgabenwechsel können dazu führen, dass alltägliche Anforderungen mehr Energie kosten.
Umwelt- und Strukturfaktoren
- Stigma und mangelnde Akzeptanz: Wenn Autismus nicht erkannt, nicht ernstgenommen oder gar als „Defizit“ betrachtet wird, fehlt oft die Bereitschaft des Umfeldes zu notwendigen Anpassungen.
- Unflexible Strukturen und Leistungsgesellschaft: Starre Arbeitszeiten, hohe soziale Erwartungen, unvorhersehbare Änderungen und sensorisch belastende Umgebungen erhöhen das Risiko.
- Fehlende Unterstützung: Unkenntnis im Umfeld, unpassende Therapien oder nicht vorhandene Akkommodationen verstärken die Belastung.
Typische Auslöser
- Übergänge wie Schulabschluss, Studienbeginn, Auszug aus dem Elternhaus, Jobwechsel oder Mutterschaft.
- Langfristige sensorische Überlastung ohne Rückzugsraum.
- Chronische Doppelt- oder Dreifachbelastung (z. B. Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, Masking im sozialen Umfeld).
Forschungsstand heute

Forschungsansätze
- Qualitative Interviews & Konsensusverfahren (z. B. Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021) legten den Grundstein für die heute gängige Definition und Beschreibung der Symptomatik2.
- Online-Analysen (Mantzalas et al., 2022) werteten Social-Media-Beiträge aus, um Belastungsfaktoren, typische Verläufe und Bewältigungsstrategien zu erfassen6.
- Messinstrumente: Mit der AASPIRE Autistic Burnout Measure (ABM) steht seit 2023 ein auf die Community zugeschnittenes Screening-Tool zur Verfügung; eine Validierungsstudie folgte 20245.
Die Forschung bestätigt die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Kernmerkmale und Belastungsfaktoren. Ergänzend liefern die Studien Hinweise darauf, dass Burnout-Episoden oft über Monate anhalten, wiederkehren können und nicht auf den Arbeitskontext beschränkt sind. Erste psychometrische Analysen zeigen, dass ABM und ausgewählte Skalen des Copenhagen Burnout Inventory Burnout-Anzeichen zuverlässig abbilden können – allerdings ohne den Anspruch einer formalen Diagnose, weil es die eben in unseren Klassifikationssystemen bisher noch nicht gibt.
Offene Fragen: Zur Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung, zu möglichen Langzeiteffekten wiederholter Burnouts und zu spezifischen Interventionsstrategien liegen bisher kaum belastbare Daten vor. Ebenso fehlen offizielle Leitlinien in DSM-5-TR oder ICD-11, wie oben bereits erwähnt.
Differenzialdiagnostik & Versorgungsfallen
Autistischer Burnout wird in klinischen Kontexten häufig übersehen oder mit anderen Zuständen verwechselt. Am häufigsten geschieht dies mit Depression, arbeitsbezogenem Burnout oder chronischen Erschöpfungssyndromen. Zwar können sich Symptome überschneiden – etwa Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug oder kognitive Einbußen – doch die Ursachen und die Dynamik unterscheiden sich deutlich. Während Depression nicht zwingend an eine Überlastungssituation gebunden ist, entsteht autistischer Burnout in der Regel aus einer anhaltenden Diskrepanz zwischen Anforderungen und verfügbaren Ressourcen, oft begleitet von Masking und sensorischer Überlastung1.
Die Abgrenzung zu arbeitsbezogenem Burnout ist ebenfalls entscheidend. Das von der WHO im ICD-11 definierte Burn-out ist ausschließlich auf den beruflichen Kontext bezogen4. Autistischer Burnout kann hingegen in jeder Lebenssituation auftreten – auch bei Menschen ohne Erwerbsarbeit – und wird oft durch eine Kombination aus sozialen, sensorischen und organisatorischen Anforderungen ausgelöst.
Ein großes Risiko ist das sogenannte diagnostic overshadowing: Dabei werden Symptome ausschließlich auf bereits bekannte Diagnosen oder stereotype Annahmen zurückgeführt, sodass zusätzliche oder spezifische Zustände nicht erkannt werden3. Im Kontext von Autismus bedeutet das häufig, dass Erschöpfung und Funktionsverluste als „typische Autismus-Merkmale“ oder als Depression eingeordnet werden – ohne zu berücksichtigen, dass gezielte Anpassungen und Entlastungen nötig wären.
Versorgungsfallen entstehen besonders dann, wenn Interventionen die Belastung weiter erhöhen. So können therapeutische oder arbeitsbezogene Maßnahmen, die auf Leistungssteigerung und „Rückkehr zur vollen Funktion“ drängen, den Zustand verschärfen. Ebenso riskant sind Behandlungsansätze, die ausschließlich auf die Beseitigung von Symptomen zielen, ohne die zugrunde liegenden Belastungsfaktoren zu reduzieren.
Ein weiteres Problem in der Versorgungspraxis ist, dass viele psychiatrische und psychosomatische Kliniken in Deutschland nicht autismusfreundlich gestaltet sind (und perspektivisch auch nicht werden, da das zu teuer würde…). Häufige Strukturen wie Zweibettzimmer, große Gemeinschaftsräume, feste Essenszeiten in lauten Speisesälen oder überwiegend gruppenbasierte Therapieangebote können für autistische Menschen extrem belastend sein. Statt zur Erholung beizutragen, verstärken solche Umgebungen oft sensorische Überlastung und sozialen Druck – gerade bei Menschen, deren Autismus in der Einrichtung nicht erkannt oder nicht berücksichtigt wird. Für manche bedeutet ein solcher Aufenthalt eine weitere Destabilisierung, anstatt den erhofften gesundheitlichen Fortschritt.
Eine neuroaffirmative Herangehensweise (egal ob im ambulanten Setting oder in stationären Kontexten) setzt stattdessen auf die Schaffung entlastender Rahmenbedingungen, Energie-Management und das Hinterfragen von Masking-Anforderungen .
Recovery & Prävention
Die Erholung von einem autistischen Burnout braucht Zeit – oft mehr, als Betroffene und ihr Umfeld zunächst erwarten (oder sich wünschen). Das allerwichtigste ist, den Belastungspegel aktiv zu senken und dabei sowohl äußere als auch innere Faktoren zu berücksichtigen. Anders als bei vielen Mainstream-Empfehlungen zu „Resilienz“ oder „Stressmanagement“ steht hier nicht Leistungssteigerung im Vordergrund, sondern eine nachhaltige Anpassung der Umgebung an die eigenen Bedürfnisse.
Das ist kontraintuitiv für viele Betroffene oder Angehörige, denn häufig herrschen noch eine gewisse Stell-dich-nicht-so-an-Mentalität und die Idee, dass man sich mit der Zeit doch bestimmt an alles Mögliche gewöhnen kann (und es dann auch nicht mehr so anstrengend ist).

Akute Erholungsphase
In der akuten Phase bedeutet das häufig: radikale Reduktion von Anforderungen, Rückzug in reizärmere Umgebungen, Abbau von Verpflichtungen und eine klare Priorisierung der eigenen Grundbedürfnisse. Manchmal hilft es, eine Liste mit „Muss“-, „Kann“- und „Kann-warten“-Aufgaben zu erstellen und konsequent alles Nicht-Dringende zu verschieben. Auch sensorische Schonräume (z. B. ein abgedunkelter, ruhiger Raum) können entscheidend sein.
Mittelfristige Stabilisierung
Sobald etwas Energie zurückkehrt, sollte es darum gehen, Dauerbelastungen zu identifizieren und gezielt zu reduzieren. Dazu gehört oft, Masking schrittweise abzubauen, Kommunikation mit klaren Vereinbarungen zu gestalten und im Alltag feste Pausen- und Erholungsfenster einzuplanen. Auch Anpassungen am Arbeitsplatz oder im Studium (asynchrone Arbeitsformen, reduzierte Präsenzpflichten, angepasste Deadlines oder sensorisch optimierte Arbeitsplätze, Homeoffice) können Rückfällen vorbeugen.
Selbstmonitoring ohne Selbstoptimierungsdruck
Ein hilfreiches Instrument ist das Energie- oder Spoon-Tracking: Dabei wird über Tage oder Wochen notiert, wie sich verschiedene Tätigkeiten auf das Energielevel auswirken. Wichtig ist, dies nicht als Leistungskontrolle, sondern als Werkzeug zur Selbstfürsorge zu nutzen. Manche Betroffene verwenden visuelle Skalen oder Farbcodes, um Muster schneller zu erkennen.
Präventive Schutzfaktoren
- Soziale Unterstützung, idealerweise in neurodivergenzfreundlichen Räumen oder Peer-Gruppen
- Offene Kommunikation mit wichtigen Bezugspersonen über Belastungsgrenzen
- Realistische Zielsetzung, die sich an vorhandenen Ressourcen orientiert
- Flexibilität in der Tagesstruktur, um auf Schwankungen reagieren zu können (Energie- statt Zeitmanagement!)
Die Forschung zu gezielten Präventionsstrategien ist noch begrenzt, doch Betroffenenberichte und Community-Wissen zeigen: Entscheidend ist nicht, „wieder so zu funktionieren wie vorher“, sondern einen lebbaren Alltag zu gestalten, der nicht dauerhaft über die eigenen Kapazitäten geht.
Für Arbeitgeber:innen & Hochschulen
Autistischer Burnout betrifft nicht nur das Privatleben, sondern oft auch die Leistungsfähigkeit in Arbeit oder Studium. Arbeitgeber:innen, Vorgesetzte und Hochschulmitarbeitende können entscheidend dazu beitragen, Burnout vorzubeugen oder die Erholung zu unterstützen, vorausgesetzt, Anpassungen orientieren sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der betroffenen Person.
Mögliche Anpassungen im Arbeitsumfeld:
- Flexibilität bei Arbeitszeiten (Gleitzeit, asynchrone Arbeit, Homeoffice-Optionen)
- Ruhige Arbeitsplätze oder Rückzugsräume, sensorisch optimierte Beleuchtung und Akustik
- Klare Kommunikation: nachvollziebare Rollenverteilung und Verantwortungsbereiche, schriftliche Zusammenfassungen, eindeutige Prioritäten, Vermeidung von Mehrdeutigkeit
- Reduzierung unnötiger Meetings und Möglichkeit zur Teilnahme per Video oder Chat
- Anpassung von Deadlines bei erhöhter Belastung oder nach Rückkehr aus einer Burnout-Phase
Anpassungen im Hochschulkontext:
- Flexible Abgabefristen und individuelle Prüfungsformate
- Möglichkeit zu Remote-Teilnahme an Vorlesungen oder Seminaren
- Zugang zu ruhigen Lernräumen und sensorischen Schonbereichen
- Bewusstsein bei Lehrkräften für autistische Kommunikations- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten
Kulturelle Aspekte:
Eine inklusionsfreundliche Haltung bedeutet, Anpassungen nicht als „Sonderregelung“, sondern als legitimen Teil von Barrierefreiheit zu betrachten. Offene Gespräche ohne Leistungsdruck und ohne Erwartung, dass die betroffene Person sich „erklären“ oder „rechtfertigen“ muss, schaffen Vertrauen und reduzieren die Gefahr erneuter Überlastung.
Quellen
- Raymaker, D. M., et al. (2020). Understanding autistic burnout through adults’ lived experience. Journal of Autism and Developmental Disorders. ↩
- Higgins, J. M., et al. (2021). Defining autistic burnout through a community-informed approach. Autism in Adulthood. ↩
- Arnold, S. R. C., et al. (2023). Autistic burnout: Frequency, duration, and misdiagnosis. Autism. ↩
- World Health Organization. (2019). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Entry: Burn-out (QD85). ↩
- Mantzalas, J., et al. (2024). Validating the AASPIRE Autistic Burnout Measure. Autism Research. ↩
- Mantzalas, J., et al. (2022). Autistic burnout as described by adults on the autism spectrum: An online thematic analysis. Autism. ↩
- Bradley, L., et al. (2021). The relationship between camouflaging and mental health in autism: A systematic review. Autism. ↩