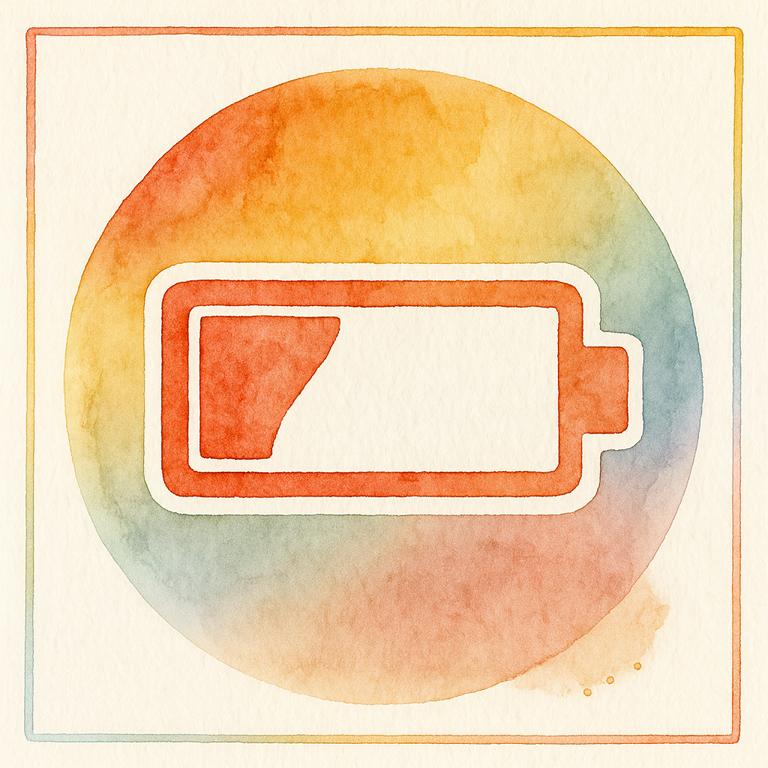Warum wir Neurovarianz toll finden
Neurodivergenz, also die neurologische Abweichung von der Norm, ist kein neues Phänomen, sondern ein neuer Blick auf eine uralte Tatsache: Nicht alle Menschen denken, fühlen und verarbeiten Reize auf dieselbe Weise. Der Begriff wurde in den 1990er-Jahren von der australischen Soziologin Judy Singer geprägt.1 Sie wollte eine Sprache schaffen, die Autismus und andere neurologische Unterschiede nicht länger als zu eliminierende „Defizite“, sondern als Varianten menschlicher Neurobiologie beschreibt.

Neurodivergenz umfasst unter anderem Autismus, ADHS, Dyslexie, Dyspraxie, Tourette-Syndrom und andere kognitive Varianten. Der Gegenbegriff ist „neurotypisch“. Entscheidend bei der Zuordnung ist dabei nicht eine offizielle Diagnose, sondern immer der individuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstil einer Person. Viele Menschen erkennen sich als neurodivergent, auch ohne (oder vor) einer formellen Diagnose.
Neurodivergenz vs. Neurodiversität
Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, gibt es einen wichtigen Unterschied:
- Neurodivergenz bezieht sich auf Individuen, deren neurologisches Profil entwicklungsbedingt von der Norm abweicht.
- Neurodiversität beschreibt die Gesamtheit neurologischer Unterschiede innerhalb der menschlichen Bevölkerung.
Alle Menschen sind Teil der Neurodiversität, aber nicht alle sind neurodivergent.
Sprache prägt unsere Sicht auf die Welt
Die Verwendung des Begriffs „Neurodivergenz“ fördert ein Verständnis, das neurologische Unterschiede nicht als pathologisch, sondern als Teil menschlicher Vielfalt betrachtet. Dies unterstützt eine inklusive Gesellschaft, die Vielfalt wertschätzt und Barrieren abbaut. Die Neurodiversitätsbewegung betont, dass viele Herausforderungen neurodivergenter Menschen nicht aus ihren neurologischen Unterschieden resultieren, sondern aus gesellschaftlichen Strukturen, die diese Unterschiede nicht berücksichtigen.
Wenn wir Neurodivergenz als normalen und wertvollen Teil menschlicher Vielfalt verstehen, statt als unangenehme Abweichung von einer idealisierten „Norm“, verschiebt sich der Blick: vom Behandeln zum Ermöglichen, vom Korrigieren und Anpassen zum Verstehen.
Autistische Menschen zeigen zum Beispiel häufig außergewöhnliche Detailwahrnehmung, analytisches Denken oder kreative Lösungsansätze. Menschen mit ADHS können in Hyperfokusphasen extrem produktiv, kreativ und ideenreich sein. Neurodivergente Menschen haben häufig eine hohe Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit, nonverbale Nuancen oder ethische Fragen.
Auch aus evolutionsbiologischer Sicht ist Vielfalt ein Vorteil: Unterschiedliche Denk- und Wahrnehmungsweisen tragen dazu bei, dass Gruppen anpassungsfähiger, kreativer und widerstandsfähiger sind2. Das gilt für soziale Gemeinschaften ebenso wie für Innovationsprozesse. Viele der weltweit bekanntesten Forscher:innen, Entdecker:innen, Künstler:innen und Revolutionär:innen waren neurodivergent.
Diese Potenziale kommen aber oft nur dann zur Geltung, wenn das Umfeld passt. Der Stress ständiger Anpassung, Reizüberflutung oder Missverständnisse im sozialen Miteinander können zu Erschöpfung, Burn-out und Isolation führen. Ein rein individueller Blick greift hier zu kurz.
Deshalb betrifft Neurodivergenz die ganze Gesellschaft
Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und neuroaffirmative Räume sind kein Luxus, sondern Grundlage für ein Leben, das sich an den Bedürfnissen Betroffener orientiert. Wir als Gesamtgesellschaft können davon profitieren, unglaublich viel von- und miteinander lernen und uns entwickeln.
Schätzungsweise sind 1-2 % der Bevölkerung autistisch3, 2,5 – 5 % der erwachsenen Menschen erfüllen die Kiterien für eine ADHS4. Inkludiert man Menschen mit Dyslexie, Dyspraxie, Tourette-Syndrom usw., kommt man auf einen Anteil von 15-20 % neurodivergenter Menschen.5
Unabhängig vom persönlichen Leid, das viele neurodivergente Menschen durch Überforderung, Missverständnisse oder Ausschluss erfahren, hat auch die Gesellschaft als Ganzes ein Interesse daran, ihre Potenziale nicht ungenutzt zu lassen. Wenn Bildungssysteme, Arbeitsmärkte und soziale Strukturen nicht inklusiv gestaltet sind, führt das nicht nur zu individuellem Rückzug, Burn-out oder Arbeitsunfähigkeit, sondern auch zu enormen gesellschaftlichen Folgekosten. Frühverrentung, psychiatrische Versorgung, Erwerbslosigkeit und soziale Isolation sind oft direkte Folgen eines Systems, das an den Bedürfnissen neurodivergenter Menschen vorbeigeht.
Es liegt also nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit, sondern auch aus ökonomischer und struktureller Weitsicht im gesamtgesellschaftlichen Interesse, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen alle ihren Platz finden und ihr Potenzial entfalten können.
Kurz gesagt: Neurodivergenz ist keine Störung, sondern eine andere Art, die Welt zu erleben. Und wir als Gesamtgesellschaft müssen an einer Welt arbeiten, in der neurodivergente Menschen nicht durch unpassende Umgebungen und Anforderungen behindert, sondern unterstützt und befähigt werden (siehe hierzu auch das Konzept der sozialen Behinderung).
Quellen:
-
- Singer, J. (1999). Why can’t you be normal for once in your life? From a „problem with no name“ to the emergence of a new category of difference. In M. Corker & S. French (Eds.), Disability Discourse (pp. 59–67). Open University Press. ↩︎
- Polimeni, J., & Reiss, J. P. (2006). Evolutionary perspectives on autism. Evolutionary Psychology, 4(1), 147470490600400102. https://doi.org/10.1177/147470490600400102 ↩︎
- Maenner, M. J. et al. (2020). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ 69(No. SS-4). https://doi.org/10.15585/mmwr.ss6904a1 ↩︎
- Faraone, S. V. et al. (2021). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based Conclusions about the Disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 128, 789–818. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022 ↩︎
- Armstrong, T. (2010). Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences. Da Capo Press. ↩︎