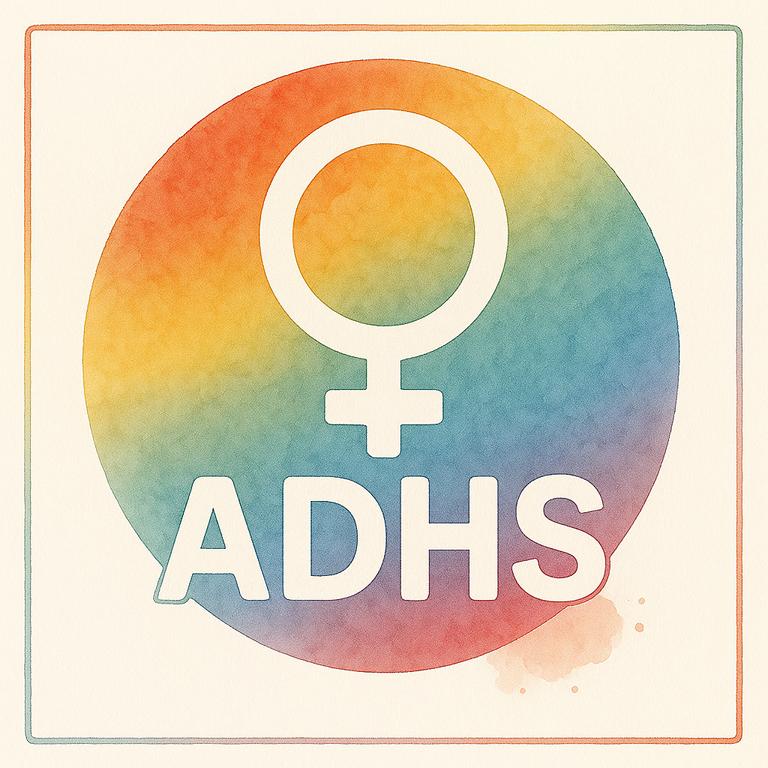Reizverarbeitung bei Autismus
Stell dir vor, du befindest dich auf einem belebten Marktplatz: Stimmengewirr, Musik aus Lautsprechern, der Geruch von Essen, das Flimmern von Werbung, vibrierende Motoren, der Wind, der Kleidung an deinem Arm streift. Für die meisten (nicht autistischen) Menschen ist das eine Kulisse, aus der sie ganz automatisch die relevanten Informationen filtern und ins Bewusstsein rücken und den Rest rasch „ausblenden“.
Doch für viele Menschen im Autismus-Spektrum ist genau das eine permanente Herausforderung: Es gibt keinen „unsichtbaren Filter“, der nervige Hintergrundgeräusche ausblendet oder flackerndes Licht in den Hintergrund rückt. Stattdessen wirkt alles gleich „gehörig“, „hell“, „spürbar“ und verlangt Aufmerksamkeit.
In diesem Artikel untersuchen wir, wie sich Reizverarbeitung bei Autismus gegenüber dem neurotypischen Verarbeitungsstil unterscheidet, und zwar auf neurologischer, kognitiver und alltäglicher Ebene. Wir schauen uns Modelle und empirische Befunde an, und wir übersetzen sie in Erleben und Verhalten. Am Ende skizzieren wir, wie dieses Wissen konkret helfen kann, zum Beispiel beim Umfeld-Design oder bei gezielten Trainingsstrategien.

1. Grundlagen: Was heißt Reizverarbeitung?
Ganz grundsätzlich interagieren wir als Lebewesen ständig mit unserer Umwelt. Unser Gehirn nimmt diverse Reize und Sinneseindrücke auf, verarbeitet diese und setzt sie zu einem sinnvollen Erleben um, welches uns hilft, uns in der Welt zurecht zu finden. Weil es sehr viele verschiedene Sinneseindrücke gibt und dieser Prozess der Verarbeitung aufwändig ist, hat das Gehirn Tricks entwickelt, um ein bisschen Energie zu sparen.
Mit dem Erwachsenwerden hat es viele Erfahrungen gesammelt und Informationen über die Welt erhalten, sodass es Schätzungen, Annäherungen, Mutmaßungen und Vorhersagen über unsere Umgebung treffen kann. Häufig sind die so nah an der „Realität“, dass jetzt nur noch ein kleiner Teil an echtem sensorischem Input nötig ist, um das Bild zu vervollständigen bzw. zu bestätigen. Zum Beispiel weißt du in deinem Kopf relativ genau, wie dein Zimmer aussieht. Wenn du es betrittst, muss dein Gehirn nun nicht alle Details wahrnehmen und verarbeiten, weil es mit einer Schätzung/Vorhersage über das Aussehen deines Zimmers arbeiten kann.
1.1 Bottom-up vs. Top-down
Bevor wir nun Unterschiede zwischen autistischen und allistischen Personen betrachten, müssen wir zwei grundlegende Richtungen der Informationsverarbeitung klären:
- Bottom-up (Datengetrieben): Sensorische Eingaben (Licht, Klang, Berührung etc.) gelangen ins Gehirn und werden zunehmend verarbeitet und integriert, bis ein Gesamtbild entsteht.
- Top-down (Vorhersagen, Erwartungen): Höhere Gehirnareale arbeiten mit Modellen der Umwelt (Erwartungen, Erfahrungen, Kontext), denen sensorische Daten gegenübergestellt werden.
Effiziente Wahrnehmung benötigt ein Zusammenspiel: Reize werden nicht nur einfach „herein gelassen“, sondern in Relation zu Erwartungen interpretiert. Stimmt der Sensorreiz mit der Vorhersage überein, wird er gedämpft behandelt; weicht er ab, erzeugt er einen Vorhersagefehler. Wenn zum Beispiel in deinem Zimmer plötzlich ein pinker Sessel steht, dann weicht das von der Vorhersage ab und gelangt ins Bewusstsein.
1.2 Präzisionsgewichtung und Vorhersagefehler
In modernen Modellen der Reizverarbeitung und -integration (z. B. predictive coding, Bayesianische Ansätze) spielt der Begriff Präzision eine zentrale Rolle: Wie stark gewichte ich einen Vorhersagefehler relativ zur Zuverlässigkeit (Unsicherheit) meiner Vorhersage? Eine hohe Präzision macht den Fehler „bedeutungsvoller“.
In unserem Zimmerbeispiel könnte eine hohe Präzision bedeuten, dass ein Möbelstück ein kleines bisschen verrückt ist und dies von der Vorhersage abweicht, was dann bewusst wahrgenommen wird. Bei einer niedrigen Präzision würde dies nicht auffallen, ebenso wenig, dass eine freundliche Person die Fenster geputzt, die Blumen gegossen, den Staub gewischt und das Bett gemacht hat.
Bei Autismus wird oft angenommen, dass die Gewichtung von Vorhersagefehlern zu starr oder überhöht ist — das heißt, selbst kleine Abweichungen werden stark beachtet.1
Je nachdem, wie stark die Präzision ist und wie bedeutsam Vorhersagefehler wahrgenommen werden, kann der betroffene Mensch besser oder schlechter irrelevante Abweichungen herausfiltern.
1.3 Reizfilterung und Filterungseffizienz
2. Neuronale Besonderheiten in der Reizverarbeitung
Jetzt wird es hier kurz etwas abstrakt und wir gehen auf neuronale Besonderheiten autistischer Menschen ein (für die Neuronerds… :-)) Wenn dich die ganzen Fachbegriffe überfordern oder wenn du keine Lust auf unser fachliches Abnerden hast, dann darfst du diesen Teil überspringen und bei Punkt 4 weiterlesen. Dort wird es wieder etwas verhaltensnäher.
2.1 Thalamus, thalamokortikale Schleifen und Filterung
Der Thalamus ist ein wichtiger „Torwächter“ für sensorische Informationen, bevor sie in die Rinde gelangen. Bei Autismus zeigen bildgebende Studien Unterschiede in der thalamokortikalen Kopplung und in der funktionellen Konnektivität sensorischer Areale (auch über Modalitäten hinweg).2 Das bedeutet, dass Reize mit geringerer Relevanz stärker weitergeleitet werden.
2.2 E/I-Balance: Exzitation und Inhibition
Viele Theorien postulieren, dass bei Autismus ein erhöhtes Verhältnis von Erregung gegenüber Hemmung (E/I) besteht, z. B. durch gestörte GABAerge oder Glutamaterge Systeme.3 Solch eine Imbalance kann dazu führen, dass Sensorneuronen leichter aktiviert werden und dass die Hemmung (Filterung) weniger restriktiv ist. In der Folge kann jeder Reiz stärker durchdringen. Das heißt: Für Betroffene fühlt es sich oft so an, als würden Reize intensiver und ungefilterter im Gehirn ankommen.
2.3 Neuromodulatorische Systeme (z. B. Noradrenalin / LC-NE)
Das Locus coeruleus – Noradrenalin-System (LC-NE) reguliert den „Gain“ (Verstärkungsfaktor) neuronaler Signale. Studien deuten darauf hin, dass bei Autismus tonische (grundlegende) Aktivität höher sein kann, was dazu führt, dass sensorische Signale mit größerem Gain durchgelassen werden. Das zeigt sich unter anderem in stärkeren Pupillenreaktionen und erhöhter körperlicher Erregung, die in Studien als indirekte Marker dieser verstärkten LC-NE-Aktivität beobachtet werden4.
Das heißt: Reize gelangen nicht nur ungefiltert ins Gehirn, sondern werden dort auch stärker „aufgedreht“ verarbeitet, sodass sie intensiver und überwältigender wirken können.
2.4 Multisensorische Integration, Timing und das Cerebellum
Reize aus verschiedenen Sinneskanälen müssen zeitlich koordiniert werden. Menschen mit Autismus zeigen oft eine verzögerte oder weniger flexible Integration (z. B. beim point of subjective simultaneity)5. Das Kleinhirn (Cerebellum) spielt eine Rolle bei dem zeitlichen Feintuning und prädiktiven Timing, und es gibt Hinweise, dass seine Konnektivität bei Autismus anders organisiert ist, was die Multisensorik stören kann. Das heißt: Das Gehirn hat mehr Mühe, Sinneseindrücke wie Hören, Sehen oder Berührung zu einem stimmigen Gesamtbild zu verbinden, sodass Situationen chaotischer, verzögert oder widersprüchlich wirken können.
2.5 Abweichende Minicolumn-Struktur im Kortex
Ein weiterer Erklärungsansatz für sensorische Unterschiede im Autismus stammt aus der Minicolumn-Forschung. Minicolumns sind kleinste vertikale Verarbeitungseinheiten im Neokortex, bestehend aus erregenden und hemmenden Nervenzellen, die Reize bündeln und weiterleiten. Studien zeigen, dass Menschen im Autismus-Spektrum oft mehr, schmalere und weniger stark gehemmt verschaltete Minicolumns aufweisen, weil im Verlauf der Entwicklung weniger synaptisches „Pruning“ (= der Prozess, bei dem das Gehirn überflüssige Synapsen und Verbindungen zurückbaut, um Netzwerke effizienter und spezialisierter zu machen) stattfindet14. Dadurch können sensorische Signale leichter von einer Minicolumn in die nächste überspringen, statt innerhalb einer Einheit begrenzt und gefiltert zu werden. Diese geringere laterale Hemmung führt zu einer Art „Überlauf“ der Reizinformation, was mit intensiverer Wahrnehmung, langsamerer Habituation und dem Erleben sensorischer Überwältigung in Verbindung gebracht wird.
Einfach gesagt: Reize bleiben nicht in einer Bahn, sondern springen im Gehirn schneller auf benachbarte Wahrnehmungsspuren über, wodurch Eindrücke stärker, voller und länger im Erleben nachhallen.
3. Aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung
Hier noch ein Überblick über interessante, neuere empirische Ergebnisse (auch noch ziemlich technisch und voller Fachwörter, überspring diesen Teil gern wenn das für dich nicht interessant ist):
3.1 Habituation & Adaptation
Autistische Personen zeigen in vielen Studien eine reduzierte Habituation (also eine Gewöhnung) an wiederholte oder gleichförmige Reize. Der neuronale und physiologische „Rückgang“ der Reaktion über Zeit ist schwächer.6 Wenn sich die Umgebung ändert (z. B. neue Frequenzbereiche), ist die Anpassung langsamer.7 Eine neuere Arbeit konnte zeigen, dass solche Unterschiede besonders in dynamischen Umgebungen sichtbar werden, bei denen Flexibilität gefordert ist.8
Das ist einer der Gründe, dass autistische Menschen häufig eine Vorliebe für und das starke Bedürfnis nach Gleichförmigkeit, Gewohntem und Routinen haben.
3.2 Präzisionsgewichtung und Vorhersagefehlerkodierung
Arbeiten zur precision weighting zeigen, dass Menschen mit autistischen Merkmalen eine besonders niedrige Toleranz gegenüber Abweichungen aufweisen, das heißt, die Präzisionsgewichtung ist zu stark auf Vorhersagefehler ausgerichtet.1
Eine neuere neuroimaging-Studie fand heraus, dass der anterior cingulate cortex (ACC) bei mittleren Vorhersagefehlern bei Neurotypischen negativ mit Aktivität korreliert (Regulation), aber bei Autisten dieser Zusammenhang fehlt. In ASD findet man stattdessen stärkere Assoziationen zwischen mittleren Fehlern und Aktivität in Regionen wie dem Putamen.9
Das bedeutet: Bei autistischen Personen reagiert das Gehirn auf Abweichungen nicht mit der üblichen top-down-Regulation durch den anterioren cingulären Cortex, sondern stärker über basalganglionäre Netzwerke wie das Putamen, was auf eine weniger kontrollierte, stärker automatisierte Verarbeitung von Vorhersagefehlern hinweist. Oder etwas einfacher: Schon kleine Abweichungen wirken für das Gehirn bedeutsam und schwerer „wegzuregulieren“, sodass Veränderungen stärker auffallen, irritieren oder Stress auslösen können, weil das Gehirn nicht automatisch bremsen und einordnen kann, sondern schneller in eine Alarm- oder Reaktionshaltung rutscht, selbst wenn die Abweichung eigentlich unwichtig wäre.
3.3 Pupillometrie, Augenbewegung, autonome Marker
Untersuchungen zeigen, dass autistische Kinder und Erwachsene stärkere Pupillenreaktionen auf Reizabweichungen zeigen, was auf erhöhte Sensitivität und Gain hinweist.10 Ebenso gibt es Hinweise auf erhöhte Herzfrequenzvariabilität, veränderte Hautleitfähigkeit oder andere körperliche Marker autonomer Reizverarbeitung.
Einfach gesagt: Der Körper reagiert messbar stärker auf Reize und Stress, und diese erhöhte Anspannung lässt sich sogar in physiologischen Signalen wie Herzschlag, Schweißreaktion oder Pupillenweite ablesen.
Manche Studien differenzieren auch zwischen Über- und Unterreaktion im Sinne von hypo- oder hyperresponsiver sensorischer Profile.11
3.4 Schmerz- und Wahrnehmungsschwellen
Eine aktuelle Studie (2025) nutzte quantitative sensorische Tests (QST) und kombinierte sie mit EEG-Messungen, um Reizschwellen und zentrale Reizverarbeitung bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu vergleichen.12 Sie fand, dass subjektive Schmerz- und Wahrnehmungsschwellen im Zusammenhang mit EEG-Signalen stehen, und verdeutlichte damit unser Verständnis darüber, wie stark das Nervensystem autistischer Menschen auf Reize reagiert, über bloße Selbstauskünfte Betroffener hinaus.
Schmerz kann bei autistischen Menschen zum Beispiel als ungewöhnlich stark wahrgenommen werden, aber auch gar nicht gespürt werden, obwohl andere Menschen in einer ähnlichen Situation starke Schmerzen hätten.
3.5 Heterogenität und Subgruppen
Nicht alle Personen mit Autismus zeigen dasselbe sensorische Muster. Manche zeigen ausgeprägt hypersensitive Profile, andere kombinieren hypo- und hyperresponive Aspekte oder variieren stark mit Kontext, Alter und Komorbiditäten.13 Die verschiedenen Studienergebnisse deuten darauf hin, dass ein einheitlicher „Sensory-Autismus-Phänotyp“ zu simpel wäre.
4. Von Gehirn zu Erleben: Was heißt das jetzt für den Alltag?
4.1 Wahrnehmung als Überfülle
Viele Menschen im Autismus-Spektrum berichten, dass sie mehr Details gleichzeitig wahrnehmen: Hintergrundgeräusche, einzelne Schritte, Kleinstbewegungen, Texturveränderungen. Da Filter weniger zuverlässig sind, konkurrieren viele Reize um Aufmerksamkeit. Manche haben das Gefühl, einfach keine Filter zu haben.
4.2 Langsame oder ausbleibende Gewöhnung
Ein Summen eines Kühlschranks, das andere kaum noch wahrnehmen, bleibt spürbar. Der Parfumgeruch, der ständige Hintergrundton, das leichte Vibrieren eines Lüfters, all das „geht nicht weg“. Diese permanente Präsenz erzeugt eine fortdauernde Belastung und Beanspruchung des Nervensystems.

4.3 Erregungszunahme, Stress und Erschöpfung
Wenn viele Reize mit hohem Gain einwandern (Reize vom Gehirn verstärkt werden), steigen das körperliche Erregungsniveau und der Stresslevel. In Alltagssituationen zeigt sich das in schneller Ermüdung, Gereiztheit, Überwältigung, Überforderungsgefühlen, innerer Unruhe und Anspannung oder dem Bedürfnis nach Rückzug. Ist das Nervensystem einer dauerhaften Überreizung ausgesetzt, droht ein autistischer Burnout.
4.4 Unsicherheit und Vorhersehbarkeitsbedürfnis
Da Vorhersagen weniger stabil und die Fehlergewichtung rigider sind, bleibt für ein autistisches Gehirn vieles unvorhersehbar, autistische Menschen sind auf eine gewisse Weise ständig „überrascht“. Das führt zu einem Bedürfnis nach Strukturen und Vorhersehbarkeit: Rituale, Routinen, Vorankündigungen, feste Abläufe, Pläne. Überraschungen und Änderungen wirken oft doppelt belastend.
4.5 Kompensation durch kognitive Strategien
Viele Autist:innen entwickeln unbewusst kompensatorische „Filterstrategien“: Sie setzen Regeln, ignorieren oder vermeiden bewusst bestimmte Reize, oder bauen Checklisten, um sensorische Überladung zu vermeiden. Solche Strategien erfordern jedoch erhebliche mentale Ressourcen (und die sind ja ohnehin schon knapp da anderweitig gefordert).
4.6 Rückzugs- und Vermeidungsverhalten
Wenn die Reizlast zu groß wird, ist Rückzug oft das effektivste Mittel. Soziale Situationen, laute Umgebungen oder wechselhafte Räume werden gemieden. Dies ist einerseits eine absolut notwendige Reizmanagementstrategie, führt andererseits aber zu Isolation, verminderten Teilhabechancen und oft einem inneren Dilemma: Einerseits Teilhabewunsch, andererseits Reizschutzbedürfnis.
5. Alltagsbereiche und beispielhafte Reizdomänen
5.1 Auditive Reize (Geräusche, Stimmen, Hintergrundlärm)
Auditive Reizüberflutung entsteht häufig in Situationen, in denen das Gehirn mehrere konkurrierende Klangquellen gleichzeitig verarbeiten und voneinander trennen muss. Dazu gehören Hintergrundgeräusche, Hall-Effekte, Musik, Stimmengewirr oder wechselnde Sprecher. Das auditive System filtert normalerweise relevante von irrelevanten Reizen, ordnet sie räumlich zu und blendet Nebengeräusche weitgehend aus. Bei vielen Autistinnen und Autisten funktioniert diese Filterleistung jedoch deutlich weniger automatisiert. Das Gehirn muss jede einzelne Schallquelle bewusst erfassen und bewerten, anstatt sie im Hintergrund „mitlaufen“ zu lassen.

Dadurch können Alltagssituationen, die für neurotypische Menschen als gesellig oder angenehm gelten, schnell überfordernd oder schmerzhaft werden. Restaurants, Cafés oder Familienfeiern mit Parallelgesprächen und Hintergrundmusik werden häufig als extrem anstrengend beschrieben. Das Gehirn ist in solchen Momenten nicht in der Lage, sich auf nur eine Stimme zu fokussieren, sondern registriert jeden Reiz mit gleicher Intensität. Die Folge ist eine dauerhafte Reizüberlastung, die zu Erschöpfung, Rückzug, Stressreaktionen oder einem Overload führen kann.

5.2 Visuelle Reize (Hell-Dunkel-Wechsel, Lichtreflexionen, Bewegungen)
Visuelle Reizüberflutung entsteht, wenn das Gehirn gleichzeitig zu viele optische Informationen verarbeiten muss. Bewegungen im peripheren Blickfeld, blinkende Lichter, Monitore, Spiegelungen, Beschilderungen oder vorbeigehende Menschen werden vom visuellen System automatisch registriert, auch dann, wenn sie eigentlich irrelevant sind. Während neurotypische Gehirne viele dieser Reize unbewusst filtern, werden sie bei Autistinnen und Autisten oft mit gleicher Priorität wahrgenommen. Dadurch entsteht ein ständiger Aufmerksamkeitswechsel, der das visuelle System stark belastet und kognitive Ressourcen auffrisst.
Besonders in Umgebungen mit hoher Reizdichte – etwa in Supermärkten, Einkaufszentren, Bahnhöfen oder an Straßenkreuzungen – können sich die einzelnen Eindrücke zu einer überwältigenden visuellen Gesamtsituation aufsummieren. Farben, Muster, Bewegungen, Werbeschilder, flackerndes Licht und wechselnde Eindrücke konkurrieren um Verarbeitungskapazität, was schnell zu Erschöpfung, Stress oder Überforderungsreaktionen führen kann.
5.3 Taktile Reize/Texturen
Das taktile System ist permanent aktiv und verarbeitet ununterbrochen Informationen von der Haut, den Gelenkrezeptoren und den Schleimhäuten. Kleidung, Etiketten, Nähte, Materialwechsel, Gürtel, Taschenriemen, Schmuck, Temperaturunterschiede, Druckpunkte oder leichte Reibung – all diese Reize werden kontinuierlich registriert. Bei vielen Autistinnen und Autisten arbeitet der neuronale Filter für solche Empfindungen weniger automatisch. Reize, die für neurotypische Menschen im Hintergrund verschwinden, bleiben im Vordergrund der Wahrnehmung bestehen und konkurrieren dauerhaft um Aufmerksamkeit.
Dadurch können Stoffe, die objektiv weich erscheinen, plötzlich als scharf, brennend oder stechend empfunden werden. Schon geringe Veränderungen (in anderer Pullover, ein neuer BH-Verschluss, ein Etikett im Nacken oder ein kleiner Temperaturunterschied zwischen Kleidungsschichten) können massiven Stress auslösen. Das Gehirn bleibt ständig im „Scan-Modus“ und überprüft, ob etwas kratzt, drückt oder irritiert. Das führt zu Erschöpfung, Anspannung, Ablenkbarkeit und im Alltag häufig zu Vermeidungsverhalten (zum Beispiel bestimmte Textilien, Schnitte oder Materialien).
Auch die Mundsensorik ist ein sensibler Bereich und häufig belastend. Konsistenz, Temperatur, Bisswiderstand oder Textur von Speisen können so dominant wahrgenommen werden, dass Essen nicht aufgrund des Geschmacks, sondern aufgrund des Gefühls im Mund abgelehnt wird. Für viele Betroffene wird die Nahrungsaufnahme dadurch zu einer wiederkehrenden Überforderungssituation, die soziale, gesundheitliche und emotionale Folgen haben kann.

5.4 Geruch & Geschmack
Der Geruchs- und Geschmackssinn arbeitet permanent im Hintergrund und bewertet jede Veränderung in der Umgebungsluft oder im Mundraum. Parfüms, Essensgerüche, Körpergerüche, Reinigungsmittel, Duftstoffe in Kosmetika, chemische Ausdünstungen von Möbeln oder Kleidung, aber auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit oder abgestandene Raumluft können sehr intensiv wahrgenommen werden. Gerüche, die für neurotypische Menschen kaum auffallen oder rasch ausgeblendet werden, bleiben für viele Autistinnen und Autisten präsent und lassen sich nur schwer ignorieren. Das Gehirn reagiert auf sie, als wären sie dauerhaft relevant, was zu Ablenkung, Anspannung oder körperlichem Unwohlsein führen kann.Einzelne Reize können dabei nicht nur „störend“, sondern überwältigend oder sogar schmerzhaft empfunden werden. Starke Parfüms, Essensschwaden im Raum oder scharfe Reinigungsgerüche können zu Fluchtimpulsen, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Überforderung führen. Ähnliches gilt für den Geschmackssinn. Manche Betroffene besitzen eine erhöhte orale Sensorik, wodurch Konsistenzen, Temperaturen oder Aromen extrem intensiv wirken. Lebensmittel werden dann nicht wegen des Geschmacks an sich, sondern aufgrund ihres Mundgefühls, ihres Geruchs oder ihrer Nachwirkungen gemieden. Das kann Essen im Alltag zu einer wiederkehrenden Belastung oder zur sensorischen Stresssituation machen, besonders in sozialen Kontexten, in denen Gerüche sich nicht kontrollieren lassen.
5.5 Multisensorische Situationen & Übergangsmomente
Die stärkste Belastung entsteht oft dann, wenn Reize aus mehreren Sinneskanälen gleichzeitig eintreffen. Orte wie Marktplätze, Schulpausenhöfe, Supermärkte, Bahnhöfe, Großraumbüros oder private Feiern stellen eine regelrechte Multiquellen-Situation dar: Stimmengewirr, Bewegung im Blickfeld, Gerüche, Temperaturwechsel, Berührungen im Gedränge, wechselnde Lichtverhältnisse, Hintergrundmusik, Durchsagen oder visuelle Werbereize laufen parallel auf das Nervensystem ein, ohne sich zeitlich oder räumlich klar zu sortieren. Das Gehirn muss gleichzeitig filtern, zuordnen, bewerten und Vorhersagen treffen; eine kognitive Hochleistungsaufgabe, die bei vielen autistischen Menschen nicht automatisiert abläuft, sondern bewusste Verarbeitung erfordert.

Besonders herausfordernd sind zudem Übergänge, weil hier mehrere Anpassungsprozesse gleichzeitig notwendig werden. Ein Wetterumschwung, das Öffnen einer Tür, der Wechsel von drinnen nach draußen, Temperatur- oder Geruchswechsel, plötzlich andere Licht- oder Akustikbedingungen — jedes dieser Elemente verändert die sensorische Lage abrupt. Während neurotypische Systeme solche Veränderungen meist unbewusst „mitregulieren“, müssen autistische Menschen sie häufig aktiv verarbeiten. Jeder Übergang kann dadurch Stress oder Kontrollverlust auslösen, selbst wenn die Situation objektiv banal wirkt.
Vor diesem Hintergrund sind klassische Bildungsumgebungen wie Schulen und Universitäten besonders anspruchsvoll. Sie bündeln über viele Stunden hinweg eine extreme Dichte sensorischer, sozialer und organisatorischer Reize: Lärm, enge Räume, wechselnde Klassenräume, Menschenmengen, Gerüche, ständig neue Aufgaben, unvorhersehbare Abläufe, soziale Anforderungen, Gruppenarbeiten, spontane Interaktionen. Für das Nervensystem bedeutet das Daueranpassung. Ohne ausreichende Regenerationsmöglichkeiten, Vorhersehbarkeit und Rückzugspausen entsteht schnell chronischer Stress, der Lernen, soziale Teilhabe und psychische Stabilität massiv beeinträchtigen kann.

5.6 Interozeption, Gleichgewicht & Koordination
Auch innere Körperwahrnehmungen (Interozeption) sowie Gleichgewicht und motorische Koordination können betroffen sein. Hunger, Sättigung, Herzklopfen, Harndrang oder Schmerz werden teils zu schwach, zu stark oder zeitlich verzögert wahrgenommen, was zu Verunsicherung und körperlichem Stress führen kann. Ebenso berichten viele Autistinnen und Autisten von Gleichgewichtsschwierigkeiten, einem unsicheren Körperschema (Wo befinde ich mich im Raum? Wie viel Platz benötige ich?) oder ruckartigen, wenig automatisierten Bewegungen.
Da das Gehirn mehr bewusste Kontrolle einsetzen muss, wird Bewegung im Alltag schneller anstrengend und weniger selbstverständlich – ob beim Sport, beim Treppensteigen oder in komplexen Umfeldsituationen mit vielen gleichzeitigen Anforderungen. Häufige Verletzungen, „Tollpatschigkeit“, Probleme mit feinmotorischen Tätigkeiten, der Sportunterricht in der Schule als Herausforderung usw. sind typische Phänomene.
6. Implikationen: Was heißt das praktisch?
Ohne zu sehr in Themen wie Energiemanagement vorzupreschen, lassen sich aus dem Verständnis von Reizverarbeitung bereits konkrete Hinweise für ein gesundes Reizmanagement und damit ein optimales Haushalten mit den eigenen Ressourcen ableiten:
6.1 Umgebungsdesign & Reizreduktion
- Räume mit weniger visueller Ablenkung sind hilfreich: ruhige Wandfarben, gleichmäßige Beleuchtung, angenehme Lichtverläufe, sensorische Oasen
- Klangmanagement: schallschluckende Materialien, Geräuschmaskierung (störende oder belastende Geräusche durch andere, gleichmäßigere oder angenehmere Klänge überdecken), akustische Dämpfung
- Textur- und Materialwahl: weiche Stoffe, nahtarme Kleidung, flexible Materialien
- Sinnesfreiräume schaffen: stille Ecken, sensorische Nischen, Optionen zur Reizreduktion (z. B. Kopfhörer, Sonnenbrillen)
6.2 Kontrollierte, graduelle Exposition & Trainings
Beim Reizstatistik-Training werden Reize (z. B. Geräusche, Lichtmuster) mit systematisch veränderter Häufigkeit oder Intensität präsentiert. Das Gehirn lernt dadurch, welche Reize stabil und welche zufällig sind, und kalibriert seine Vorhersagen präziser.
Beim Üben von Veränderungsvorhersagen geht es darum, kleine, vorhersehbare Reizänderungen anzukündigen oder kontrolliert einzuführen, damit das Gehirn lernt, dass nicht jede Abweichung bedrohlich oder unvorhersagbar ist.
Die Sensibilisierung für Multisensorik zielt darauf, verschiedene Sinneskanäle (z. B. Sehen und Hören) gezielt gemeinsam zu trainieren, um deren Integration zu verbessern und zeitlich besser abzustimmen.
Das Ziel dieser Interventionen ist keine Desensibilisierung, sondern eine Verbesserung der Reizfilterung und der Vorhersagefähigkeit des Gehirns, damit Reize weniger überwältigend wirken und die sensorische Welt stabiler und vorhersagbarer erscheint.
6.3 Hilfsmittel
- Geräuschfilter (Noise-Cancelling-Kopfhörer)
- Dimmbare Lichtquellen, Sonnenbrillen, Lichtfilter
- Kleidung mit variablen Texturen, druckreduzierende Optionen
- Gewichtskissen, -decken oder -westen helfen, das Nervensystem zu regulieren
- Olfaktorische Hilfsmittel wie Kräuterkissen, Duftstäbchen oder ätherische Öle
6.4 Frühzeitige Anpassung & Umweltgestaltung
Je früher in Umwelt (z. B. Schule, Arbeitsplatz) Reizsteuerungsprinzipien eingebracht werden, desto weniger muss das Individuum im Nachhinein kompensieren. Solche Anpassungen reduzieren Stress, schonen kognitive Ressourcen und verhindern chronische Überlastung und ermöglichen gleichzeitig, dass autistische Personen ihr Potenzial besser entfalten können.
7. Fazit: Die Welt durch andere Filter
Menschen im Autismus-Spektrum erleben oft eine sensorisch intensivere Welt, in der Filter weniger zuverlässig arbeiten, Vorhersagen instabiler sind und Reizabweichungen stärker gewichtet werden. Das Ergebnis ist ein konstant gefülltes Wahrnehmungsfeld mit permanenten Überraschungen, das fortwährende Aufmerksamkeit verlangt und zu Stress, Erschöpfung und Rückzug führen kann.
Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass es keine einheitliche Sensitivität gibt: Subtypen, Kompensation, Kontextabhängigkeit und individuelle Ressourcen spielen eine große Rolle.
Wenn wir diese Erkenntnisse nutzen, können wir Umgebungen gestalten, Trainings konzipieren und Hilfsmittel optimieren, um die Reizverarbeitung behutsam zu unterstützen, ohne Masking oder Überkompensation zu erzwingen.
7.1 Dein individuelles Reizverarbeitungsprofil
Möchtest du mehr über dein persönliches sensorisches Profil herausfinden? Hier kannst du einen Test machen, der dir hilft, zu verstehen, wie dein Gehirn Reize verarbeitet.
7.2 Autistische Neurologie als Ressource
Dein Gehirn funktioniert anders und das ist neuronal begründet. Kein subjektives Empfinden, kein Defizit, kein „sich anstellen“, kein Versagen.
Und dieses anders hat auch positive Aspekte. Empfänglich für die Umwelt zu sein, bedeutet auch, Schönes intensiver wahrnehmen und genießen zu können. Ein achtsamer Waldspaziergang mit all den tollen Sinneseindrücken und Details der Natur, der Geruch des Frühlings, eine neue Knospe im Baum, die am Vortag noch nicht da war, oder auch die perfekte Konsistenz deines Safe Foods: All das kann wahre Glücksgefühle (sogenannte autistic joy) auslösen – ein Zustand der allistischen Personen verwehrt bleibt.
Quellen:
- Lawson, R. P., Rees, G., & Friston, K. J. (2014). An aberrant precision account of autism. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 302. DOI: 10.3389/fnhum.2014.00302 ↩︎
- Sapey-Triomphe, L.-A., et al. (2023). Neural correlates of hierarchical predictive processes in autism and neurotypicals.
Nature Communications, 14(1), 379. DOI: 10.1038/s41467-023-35987-9 ↩︎ - Cannon, J., Monaghan, J., & Pecenka, N. (2021). Prediction in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Frontiers in Neuroscience. DOI: 10.3389/fnins.2021.699741 ↩︎
- Aston-Jones, G., & Waterhouse, B. (2016). Locus coeruleus: From global projection system to adaptive regulation of behavior. Brain Research. DOI: 10.1016/j.brainres.2016.03.001 ↩︎
- Stevenson, R. A., et al. (2016). Multisensory temporal integration in autism spectrum disorders.
Cerebral Cortex, 26(4), 1794–1806. DOI: 10.1093/cercor/bhv028 ↩︎ - Sapey-Triomphe, L.-A., et al. (2023). Disentangling sensory precision and prior expectation in autistic perception.
npj Science of Learning, 8, 12. DOI: 10.1038/s41539-023-00186-w ↩︎ - Millin, R., et al. (2022). Habituation differences in autism: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2022.104645 ↩︎
- Nicolardi, V., et al. (2025). Pain perception in autism: Integrating quantitative sensory testing and EEG. Frontiers in Neuroscience. DOI: 10.3389/fnins.2025.1438623 ↩︎
- Todorova, G. K., et al. (2024). Special treatment of prediction errors in autism spectrum disorder. Brain, 147(2), 365–379. DOI: 10.1093/brain/awad001 ↩︎
- Anderson, C. J., Colombo, J., & Shaddy, D. J. (2019). Pupillometry in autism spectrum disorder: A systematic review. Developmental Psychobiology. DOI: 10.1002/dev.21868 ↩︎
- Schoen, S. A., Miller, L. J., Brett-Green, B., & Nielsen, D. (2009). Physiological and behavioral differences in sensory processing: A comparison of children with autism spectrum disorder and typical development. Frontiers in Integrative Neuroscience, 3, 26. DOI: 10.3389/neuro.07.026.2009 ↩︎
- Tavassoli, T., & Baron-Cohen, S. (2020). The heterogeneity of sensory profiles in autism spectrum disorder: A systematic review. Autism Research. DOI: 10.1002/aur.2390 ↩︎
- Kirby, A. V., et al. (2019). Parent descriptions of sensory processing in autism spectrum disorder: A qualitative study. Autism, 23(6), 1515–1526. DOI: 10.1177/1362361319846554 ↩︎
- Casanova, M. F., Buxhoeveden, D., & Brown, C. (2002). Clinical and macroscopic correlates of minicolumnar pathology in autism. Journal of Child Neurology, 17(9), 692–695. https://doi.org/10.1177/088307380201700908 ↩︎